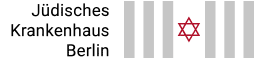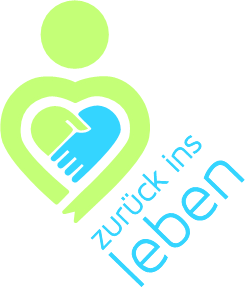Komplexes Geschehen:
Prof. Dr. Christoph Desjardins sieht Unternehmen beim Gegensteuern in der Pflicht - Verbesserung der Unternehmenskultur statt Misstrauen
Die von Unternehmen und Krankenkassen gemeldeten Zahlen zum Krankenstand deutscher Arbeitnehmer*innen kennen nur eine Richtung: nach oben.
Nachdem die durchschnittlichen Krankentage 2015 noch bei zehn lagen, ist dieser Wert laut Statistischem Bundesamt 2023 auf 15 geklettert.¹
Während Gewerkschaften die Verantwortung der Unternehmen für die Gesundheit ihrer Beschäftigten anmahnen, suchen diese händeringend nach Maßnahmen, um den Krankenstand zu senken.
Hierbei ist Misstrauen gegenüber der eigenen Belegschaft und ihrer Leistungsbereitschaft nicht zielführend, so Prof. Dr. Christoph Desjardins.
Der Experte für Human Resource Management (HRM) und Leadership der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) sieht in seiner Analyse vielmehr das Management in der Pflicht. Unternehmen müssten die Ursachen für den hohen Krankenstand erforschen und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen.
Arbeitsüberlastung und dysfunktionales Fuhr uns erhalten::
Die Frage nach den genauen Ursachen des gestiegenen Mitarbeiterausfalls ist bislang wissenschaftlich ungeklärt.
Aus der Sicht der Arbeitnehmervertretungen liegen die primären Ursachen in den verschiedenen Faktoren der Arbeitsplatzgestaltung, die durch die Unternehmen verantwortet werden.
Dazu gehören die Arbeitsüberlastung und ein dysfunktionales Führungsverhalten, die sich beide negativ auf das psychische und physische Wohlbefinden auswirken.
Eine erhöhte Arbeitsbelastung kann durch den zunehmenden Effizienz- und Leistungsdruck in den Unternehmen entstehen.
Dieser kann auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch auf unbesetzte Stellen zurückgeführt werden. Der Fachkräftemangel wird vor allem durch den demografischen Wandel getrieben. Dieser führt auch dazu, dass die Belegschaften im Durchschnitt älter sind, was als weitere Ursache für steigende Fehlzeiten angenommen werden kann.
Wertewandel in der deutschen Gesellschaft::
Auffällig ist der starke Anstieg des Krankenstandes seit der Covid-19-Epidemie. Hier muss laut Desjardins untersucht werden, ob – insbesondere bei älteren Arbeitnehmer*innen – gesundheitliche Veränderungen eingetreten sind, die zu entsprechenden Fehlzeiten führen.
„Um den bisher genannten Ursachen auf den Grund zu gehen, steht den Unternehmen ein bekanntes, aber nur selten systematisch genutztes Instrumentarium zur Verfügung“, so Desjardins.
„Dazu gehören die Analyse der Belegschaftsstruktur, die Messung und Reduzierung physischer und psychischer Belastungen am Arbeitsplatz sowie die kontinuierliche Bewertung und Verbesserung der Unternehmens- und Führungskultur.“
Entsprechende Studien² weisen auf einen Wertewandel in der deutschen Gesellschaft als weitere mögliche Ursache für den erhöhten Krankenstand hin.
Die ins Arbeitsleben eintretende Generation Z legt Wert auf private Beziehungen und Aktivitäten in der Freizeit, und die Bindung an den Arbeitgeber nimmt bei allen Beschäftigten ab.
Hinzu kommt, dass die Verbreitung von Homeoffice und der veränderte Arbeitsmarkt einen Jobwechsel für Fachkräfte problemlos möglich machen.
So machen sich einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge rund 85 Prozent der Befragten keine Sorgen darüber, in den nächsten zwei Jahren ihren Arbeitsplatz zu verlieren.³
Die veränderten Erwartungen jüngerer Beschäftigter an ihre Arbeit führen auch zu höheren Ansprüchen an die Sinnhaftigkeit der Arbeitsaufgaben und an eine wertschätzende Führung.
Werden diese nicht erfüllt, kommt es sehr schnell zu einer Verringerung der Arbeitszufriedenheit mit den möglichen Folgen von Fehlzeiten und späterem Arbeitsplatzwechsel.
Seit Corona höhere Sensibilität für Erkrankungen::
Weitere Einstellungsveränderungen kann auch die Covid-19 Epidemie ausgelöst haben.
Als Langzeitfolge ist die psychische Belastbarkeit der Menschen gesunken, was sich entsprechend im Krankenstand niederschlagen kann.
Eine weitere Folge könnte eine veränderte Einstellung zur eigenen Erkrankung und zur Ansteckungsgefahr für andere sein.
So kann die Selbstbeobachtung und -bewertung körperlicher Symptome zu einer niedrigeren Schwelle für die Selbstdiagnose einer Erkrankung führen. Menschen fühlen sich schneller krank und verhalten sich entsprechend.
„Es ist aber auch denkbar, dass eine höhere Sensibilität gegenüber der Ansteckungsgefahr von Kolleginnen und Kollegen besteht und deshalb bei Infektionskrankheiten der Kontakt eher vermieden wird“, so der Arbeits- und Organisationspsychologe.
Diese Vielzahl möglicher Einflussfaktoren auf die individuelle Entscheidung, sich krank zu melden, zeigt laut Desjardins die Komplexität des Geschehens.
„Das Beklagen eines als negativ empfundenen Wertewandels hilft den Unternehmen hier nicht weiter.
Menschen können ihre Werte und Einstellungen zwar reflektieren, aber in der Steuerung menschlichen Verhaltens wirken diese in der Regel unbewusst, so dass moralische Appelle hier wirkungslos bleiben.“
Mehr Forschung für die betriebliche Praxis::
Was aber können betroffene Unternehmen tun?
„Nach der Erledigung der organisatorischen Hausaufgaben ist es notwendig, die Einstellungen und Erwartungen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu verstehen.
Da die einzelnen Kognitionen, z. B. die durch die Covid-Epidemie ausgelösten, noch wenig erforscht sind, bietet sich hier eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft an, um entsprechende Erkenntnisse für die betriebliche Praxis zu gewinnen“, so Desjardins.
„Je nach Ergebnis dieser Analyse gilt es dann, konstruktiv mit den Auswirkungen umzugehen. Dies kann z. B. durch einen erhöhten Führungs- und Betreuungsaufwand für die Angehörigen der Generation Z geschehen oder durch den Versuch, nicht realitätsbezogene Vorstellungen durch geeignete Maßnahmen zu korrigieren, z. B. durch Hinweise zur realistischen Einschätzung der Ansteckungsgefahr bei Infektionen.“
MaAB-Cave:
Ein dramatischer Rückgang des derzeitigen Krankenstandes ist nach seiner Einschätzung schon aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen nicht zu erwarten.
„Da sich diese eher noch verschärfen werden, können Unternehmen aber durch eine differenzierte Analyse und eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Ursachen den Anstieg zumindest verlangsamen und im Idealfall sogar umkehren.“
Zur Person:
Prof. Dr. Christoph Desjardins hat seit April 2023 an der Frankfurt UAS eine Professur für Human Resource Management (HRM) und Leadership. Er ist Diplom-Psychologe und hat im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Goethe Universität promoviert. Seine Forschungsschwerpunkte sind Führung, Teamstrukturen und Change Management. Er ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für Mixed Leadership (IML) der Frankfurt UAS. Vor seinem Ruf an die Frankfurt UAS war er Professor für HRM und Consulting an der Hochschule Kempten und dort zudem zehn Jahre lang Leiter der Kempten Business School. Davor war er als Berater und Manager bei der Firma Accenture tätig.
¹siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension...
²siehe: https://iab.de/dossier/?id=20956
³siehe: https://www.iwkoeln.de/studien/holger-schaefer-wer-zaehlt-sich-zu-den-verlierern...
MaAB - Medizin am Abend Berlin Fortbildung en VOR ORT
Frankfurt University of Applied Sciences, Fachbereich Wirtschaft und Recht, Prof. Dr. Christoph Desjardins, Telefon: +49 69 1533-2995, E-Mail: