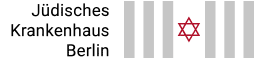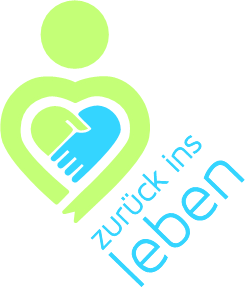Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Arterienverbindungen verbessern Therapieerfolg nach einem Schlaganfall
- Blutgefässe, die benachbarte Arterienbäume miteinander verbinden, regulieren die Wiederdurchblutung des Gehirns nach einem Schlaganfall.
Wie Forschende der UZH zeigen, verhindern sie, dass es nach der Entfernung eines Blutgerinnsels zu Hirnblutungen kommt.
Damit spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Erholung von Patientinnen und Patienten.
Darstellung der Blutgefässe im Gehirn eines Patienten ohne frühe venöse Füllung P. Thurner und Z. Kulcsar Universitätsspital Zürich
Beim ischämischen Schlaganfall – auch Hirninfarkt genannt – werden Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen, eingeengt oder verschlossen.
Das Hirngewebe erhält ungenügend Energie und Sauerstoff,
was zu Symptomen wie Lähmungen, Bewusstseinsstörungen, Schwindel,
Schmerzen, gestörter Sprache – oder zum Tod – führt.
Viele Schlaganfallpatienten genesen trotz erfolgreicher Behandlung schlecht
Um die Schlaganfallsymptome zu behandeln, muss das verstopfte Gefäss
wieder geöffnet werden.
Dies geschieht medikamentös oder mit Hilfe eines Katheters.
Doch selbst wenn das Gerinnsel rechtzeitig entfernt wird,
erholen sich viele Schlaganfallpatientinnen und -patienten nur schlecht.
Die Forschungsgruppe von Susanne Wegener, Professorin an der Universität
Zürich (UZH) und leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie des
Universitätsspitals Zürich (USZ), zeigt nun, dass der Erfolg der
Schlaganfallbehandlung vom sogenannten Kollateral-Netzwerk abhängt.
- Kollateralen sind Blutgefässe, die benachbarte Arterienbäume miteinander verbinden und als potenzielle Umleitungen im Falle einer Gefässverstopfung fungieren.
- «Diese Gefässbrücken erhalten die Selbstregulierung des Gehirns aufrecht und ermöglichen eine langsamere, allmähliche Wiederdurchblutung, was zu kleineren Infarkten führt», sagt Wegener.
Überschiessende Wiederdurchblutung erhöht Sterblichkeit
Darstellung der Blutgefässe im Gehirn eines Patienten mit früher venöser Füllung P. Thurner und Z. Kulcsar Universitätsspital Zürich
Für ihre Arbeit verwendete das Forscherteam um die beiden Erstautoren Nadine Binder und Mohamad El Amki ein Mausmodell für Schlaganfälle sowie mehrere moderne Bildgebungsverfahren, um Veränderungen in der arteriellen Blutzufuhr am lebenden Organismus zu untersuchen.
Bei Versuchstieren, die über schlechte Kollateralen verfügen, waren die Arteriensegmente nach der Gerinnselentfernung dysfunktional und starr.
«Die darauffolgende übermässige Wiederdurchblutung führte bei den Mäusen
zu Blutungen und einer erhöhten Sterblichkeit», so Wegener.
Die Ergebnisse aus dem Mausmodell konnten die Forschenden anschliessend
auch bei Schlaganfallbetroffenen bestätigen: Patientinnen und Patienten
mit schlechten Kollateralen zeigten nach erfolgter Öffnung des
verstopften Blutgefässes eine ähnlich schnelle und übermässige
Wiederdurchblutung des Hirnareals wie die Mäuse.
Auch bei ihnen kam es
zu kleinen Blutungen im Gehirn, und ihre Genesung war schlechter.
- Je besser die Arterienverbindungen, desto besser die Erholung
- Bisher stand die schnelle Entfernung des Gerinnsels bei Patienten mit Schlaganfall im Vordergrund.
- Die Probleme durch zu schnelle Wiederdurchblutung nach der Therapie und ihre potenziell schädlichen Auswirkungen bei Schlaganfallpatienten wurden bislang allerdings kaum beachtet.
Nun ist es möglich, Schlaganfallpatienten mit erhöhtem Risiko während der Entfernung des Blutgerinnsels anhand der Geschwindigkeit der Wiederdurchblutung zu identifizieren.
«Künftige therapeutische Massnahmen sollten darauf abzielen, die Funktion der Gefässbrücken zu verbessern, um eine günstige, graduelle Wiederdurchblutung nach dem Schlaganfall zu ermöglichen», so das Fazit von Susanne Wegener
Prof. Dr. med. Susanne Wegener
Klinik für Neurologie
Universität Zürich und Universitätsspital Zürich
Tel. +41 44 255 55 11
E-Mail: susanne.wegener@usz.ch
Kurt Bodenmüller Universität Zürich
Seilergraben 49
8001 Zürich
Schweiz
Zürich
E-Mail-Adresse: mediarelations@kommunikation.uzh.ch
Beat MüllerTelefon: (0041) 44-634 4432
Fax: (0041) 44-634 2346
E-Mail-Adresse: beat.mueller@kommunikation.uzh.ch
Kurt Bodenmüller
Telefon: +41446344439
Fax: +41446342346
E-Mail-Adresse: kurt.bodenmueller@kommunikation.uzh.ch
Originalpublikation:
Nadine Felizitas Binder, Mohamad El Amki, et. al. Leptomeningeal Collaterals Regulate Reperfusion in Ischemic Stroke and Rescue the Brain from Futile Recanalization. Neuron. February 26, 2024. DOI: 10.1016/j.neuron.2024.01.031