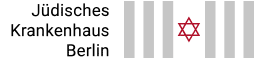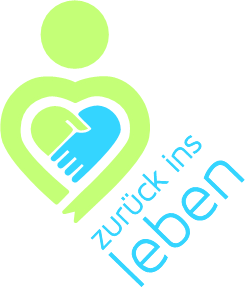Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Schlaganfall-Reha: Entspannung besser als Laufbandtraining?
Fortschritte in der Schlaganfalltherapie führen zu einem immer besseren Überleben.
Es steigt dadurch aber auch die Zahl der Patienten, die nach Schlaganfall mit bleibenden Behinderungen leben müssen. Somit kommt der Rehabilitation eine wachsende Bedeutung zu.
Derzeit ist die Datenlage dazu, welche Trainingsmethode am erfolgversprechendsten ist, widersprüchlich.
Medizin am Abend Berlin ZusatzFachThema: Pflegeheime
- Das von den amerikanischen Fachgesellschaften empfohlene Ausdauertraining zeigte sich in einer aktuellen, prämierten Studie [1] gegenüber einer Entspannungstherapie als nicht überlegen.
Die neuen Daten deuten darauf, dass in der Frühphase nach einem Schlaganfall „weniger vielleicht mehr“ ist.
Weltweit erleiden jährlich 10 Millionen Menschen einen Schlaganfall [2]. Davon erholt sich mindestens ein Drittel funktionell nicht wieder vollständig [3, 4]. Medikamente zur effektiven Unterstützung der Rehabilitation stehen nicht zur Verfügung – das Vorgehen der Wahl besteht in Physio- und Ergotherapie, – im Falle von Sprachstörungen – in der Logopädie sowie in neuropsychologischen Maßnahmen. Laufband-Training kann Geschwindigkeit und Ausdauer beim Gehen und Treppensteigen verbessern und einer zunehmenden Dekonditionierung vorbeugen.
Zusätzlich könnte die Neuroplastizität des Gehirns gefördert und somit das Outcome verbessert werden. Daher empfiehlt die „American Heart Association/American Stroke Association” Schlaganfallpatienten ab der subakuten Phase 3-5 x wöchentlich 20-60 Minuten aerobes Training (Ausdauertraining) bei 55-80% der maximalen Herzfrequenz [5].
Die Datenlage zu den Ergebnissen einer solchen Schlaganfall-Reha ist allerdings widersprüchlich.
Manche Studien zeigten eine Verbesserung des maximalen Gehtempos oder einen Anstieg des „Barthel Index“, eines Scores zur Objektivierung von Behinderungen in grundlegenden Alltagsfunktionen.
Metaanalysen lieferten dagegen uneinheitliche Ergebnisse eines körperlichen Trainings [6]. Auch die LEAPS-Studie [7] („Locomotor Experience Applied Post-Stroke“) zeigte keine Outcome-Unterschiede für die Laufband-Trainingstherapie versus eines häuslichen Übungsprogramms – allerdings wurde in dieser Studie kein aerobes Training in der Frühphase nach Schlaganfall eingesetzt. „Generell lassen sich die Studien wegen der Unterschiede im Hinblick auf Art, Intensität und Zeitpunkt des Trainingsbeginns schwer vergleichen“, erklärt Frau Prof. Dr. Agnes Flöel, Direktorin der Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin Greifswald.
„Insbesondere für Patienten in der Frühphase nach einem Schlaganfall bestehen Unsicherheiten, welches Training optimal ist.“
Die deutsche, multizentrische Studie „PHYS-STROKE“ („Physical Fitness Training in Patients with Subacute Stroke“) [1], die innerhalb des Center for Stroke Research Berlin (CSB) an der Charité gefördert wurde, untersuchte unter der Leitung von Frau Prof. Flöel daher randomisiert, kontrolliert und endpunktverblindet die Effekte eines aeroben Laufband-Trainings mit Beginn in der Frühphase nach einem Schlaganfall.
Die PHYS-STROKE-Studie wurde zwischen 2013-2017 an sieben deutschen, stationären Rehabilitationskliniken durchgeführt. Evaluiert wurde die Sicherheit und Effektivität der frühen Lokomotionstherapie mit dem Laufband (5-45 Tage nach dem Ereignis, median 28). 200 erwachsene Schlaganfallpatienten wurden 1:1 in zwei Gruppen randomisiert. Das mittlere Alter lag bei 69 Jahren, 41% waren Frauen. Die Patienten waren mittelschwer bis schwer betroffen (medianer National Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] 8 [IQR 5-12]).
Die Studiengruppe (n=105) absolvierte zusätzlich zu den Standard-Rehamaßnahmen ein aerobes Laufband-Training, die Kontrollgruppe (n=95) nahm neben den Standard-Rehamaßnahmen an Entspannungs-Einheiten teil (n=95). Jede Gruppe absolvierte das jeweilige Training fünfmal wöchentlich, jeweils 25 Minuten, über insgesamt vier Wochen. Nach dieser Zeit nahmen die Patienten weiter an der Standardtherapie teil. Primäres Outcome waren die maximale Gehgeschwindigkeit (in m/s über eine 10-m-Strecke) und Alltagsaktivität der Patienten (Barthel Index 0-100, wobei ein höherer Wert weniger Behinderung bedeutet) – gemessen drei Monate nach dem Schlaganfall. Als schwere unerwünschte Ereignisse galten kardiovaskuläre Ereignisse einschließlich erneutem Schlaganfall, Rückverlegung in ein Akutkrankenhaus und Tod. Im Ergebnis hatte das Laufband-Training nach drei Monaten nicht zur signifikanten Verbesserung des maximalen Gehtempos oder des Barthel Index geführt. Insgesamt gab es in der Laufband-Gruppe jedoch 1,8-mal mehr schwere Ereignisse (22/105 vs. 9/95 Patienten in der Kontrollgruppe) und 2,5-mal mehr Klinikaufnahmen (14/105 vs. 5/95). Zu erneuten Schlaganfällen kam es bei 8/105 vs. 3/95 Patienten, Herzinfarkte traten keine auf, dagegen kam es in der Laufband-Gruppe häufiger zu Stürzen (36/105 vs. 14/95), wenn auch ohne Knochenbrüche. In der Kontrollgruppe gab es einen Todesfall.
„Zusammenfassend war das frühe vierwöchige Laufband-Training hinsichtlich des maximalen Gehtempos und der Alltags-Fitness nach drei Monaten dem Entspannungstraining nicht überlegen“, so Prof. Martin Ebinger, Medical Park Berlin Humboldtmühle, der an der Planung und Durchführung der Studie beteiligt war.
„Die vorliegenden Daten sprechen also dafür, bei mittel- bis schwer betroffenen Patienten in der subakuten Phase nach Schlaganfall aerobes Training nicht zu forcieren.
- Möglicherweise könnten aber leichter betroffene Patienten schon früher profitieren.
Die Arbeit vom Team des CSB [1] wurde aktuell mit dem „QUEST Award for Null Results“ vom „Berlin Institute of Health“ (BIH), einer biomedizinischen Forschungseinrichtung der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, ausgezeichnet [8]. Das „Quest Center“ des BIH hat zum Ziel, Qualität und Nutzen der medizinischen Forschung zu fördern – unter anderem durch Publikation gut durchgeführter, aber „negativer“ Studien, d. h. sogenannter NULL-Ergebnisse. Denn negative Studienergebnisse haben eine oft unterschätzte Bedeutung, sie sind ein wichtiger Bestandteil der wissenschaftlichen Diskussion über die Effizienz verschiedener Therapieansätze. Werden negative Studienergebnisse nicht veröffentlicht, entsteht ein verzerrtes Gesamtbild in der wissenschaftlichen Literatur (Publikationsbias).
Literatur
[1] Nave AH, Rackoll T, Grittner U et al. Physical Fitness Training in Patients with Subacute Stroke (PHYS-STROKE): multicentre, randomised controlled, endpoint blinded trial. BMJ 2019; 366: l5101, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l5101 (Published 18 September 2019)
[2] Feigin VL, Norrving B, Mensah GA. Global Burden of Stroke. Circ Res 2017; 120: 439-48
[3] Wolfe CDA, Crichton SL, Heuschmann PU et al. Estimates of outcomes up to ten years after stroke: analysis from the prospective South London Stroke Register. PLoS Med 2011; 8: e1001033
[4] Crichton SL, Bray BD, McKevitt C et al. Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87: 1091-8
[5] Billinger SA, Arena R, Bernhardt J et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014; 45: 2532- 53
[6] Saunders DH, Sanderson M, Hayes S et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane [7] Duncan PW, Sullivan KJ, Behrman AL et al. LEAPS Investigative Team. Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke. N Engl J Med 2011; 364: 2026-36
[8] https://www.bihealth.org/de/forschung/quest-center/initiativen/null-und-replikat...
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN) sieht sich als neurologische Fachgesellschaft in der gesellschaftlichen Verantwortung, mit ihren über 9800 Mitgliedern die neurologische Krankenversorgung in Deutschland zu sichern. Dafür fördert die DGN Wissenschaft und Forschung sowie Lehre, Fort- und Weiterbildung in der Neurologie. Sie beteiligt sich an der gesundheitspolitischen Diskussion. Die DGN wurde im Jahr 1907 in Dresden gegründet. Sitz der Geschäftsstelle ist Berlin. www.dgn.org
Präsidentin: Prof. Dr. med. Christine Klein Stellvertretender Präsident: Prof. Dr. med. Christian Gerloff Past-Präsident: Prof. Dr. Gereon R. Fink
Originalpublikation:
doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l5101Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Generalsekretär: Prof. Dr. Peter Berlit Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Thomas Thiekötter Geschäftsstelle: Reinhardtstr. 27 C, 10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 531437930, E-Mail: info@dgn.org
c/o Jakobstraße 38
99423 Weimar
Deutschland
Thüringen
E-Mail-Adresse: presse@dgn.org
Dr. Bettina Albers
Telefon: 03643 / 776423
Fax: 03643 / 776452
E-Mail-Adresse: presse@dgn.org