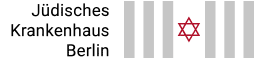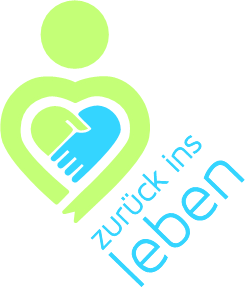Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Vom harmlosen Hautbakterium zum gefürchteten Infektionserreger
Internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Tübingen entdeckt, dass ein zusätzlicher Baustein in der Zellwand Staphylokokken gefährliche Eigenschaften verleiht
- Das Bakterium Staphylococcus epidermidis kommt meist als harmlose Art auf der menschlichen Haut und in der Nase vor.
- Doch können einige Stämme schwer behandelbare Infektionen von Kathetern, künstlichen Gelenken und Herzklappen oder in der Blutbahn hervorrufen.
- Häufig sind sie zudem resistent gegen das besonders wirksame Antibiotikum Methicillin und zählen zu den gefürchteten Krankenhauskeimen.
- Wie aus den harmlosen Hautkeimen plötzlich gefährliche Infektionserreger werden konnten, war bislang weitgehend unklar.
Ein internationales Forschungsteam hat nun entdeckt, was die friedlichen
Mitbewohner unter den S. epidermidis-Bakterien von vielen der
gefährlichen Invasoren unterscheidet.
Bei vielen der Letzteren identifizierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein neues Gencluster, das den Bakterien zu zusätzlichen Strukturen der Zellwand verhilft. Damit können sich die Staphylokokken leichter an menschliche Wirtszellen in der Blutbahn anheften; sie werden dadurch zu Krankheitserregern.
Möglicherweise kann über diese Zellwandstrukturen
auch die Methicillinresistenz verbreitet und beispielsweise von
Staphylococcus epidermidis auf die noch gefährlichere Schwesterart
Staphylococcus aureus übertragen werden.
Die Studie wurde unter der Leitung von Forscherinnen und Forschern des
Exzellenzclusters „Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von
Infektionen“ (CMFI) der Universität Tübingen und des Deutschen Zentrums
für Infektionsforschung (DZIF) in Zusammenarbeit mit Universitäten in
Kopenhagen, Hamburg, Shanghai und Hannover und des Deutschen Zentrums
für Lungenforschung (DZL) in Borstel durchgeführt und im Fachmagazin
Nature Microbiology veröffentlicht.
Die Struktur macht den Unterschied
Die Zellwand der Staphylokokken – wie auch anderer grampositiver
Bakterien – besteht zu einem erheblichen Anteil aus Teichonsäuren. Sie
ragen kettenartig nach außen und sind in artspezifischen Varianten mit
unterschiedlicher chemischer Struktur bekannt. „Bei unseren
Untersuchungen haben wir festgestellt, dass viele krankheitserregende
Stämme von S. epidermidis ein zusätzliches Gencluster besitzen, das die
Informationen zur Herstellung der eigentlich für S. aureus typischen
Wandteichonsäuren enthält“, berichtet die Forscherin Xin Du vom
Exzellenzcluster CMFI und vom DZIF. Experimente hätten ergeben, dass S.
epidermidis-Bakterien mit der arttypischen Wandteichonsäure allein wenig
invasiv sind und Haut- und Schleimhautoberflächen besiedeln.
Komme die für S. aureus typische Wandteichonsäure hinzu, könnten sie dort weniger gut wachsen und drängen stattdessen erfolgreicher in die Gewebe ihres menschlichen Wirts ein.
„Irgendwann haben einige S. epidermidis-Klone
die entsprechenden Gene von S. aureus übernommen und sind so zu
bedrohlichen Krankheitserregern geworden“, sagt Professor Andreas
Peschel vom Exzellenzcluster CMFI und dem DZIF.
Seit langem ist bekannt, dass Bakterien Eigenschaften untereinander per
Gentransfer übertragen können.
Den Transfer übernehmen Bakteriophagen, das sind Viren, die Bakterien befallen.
Dies geschieht meist innerhalb einer Art und setzt gleiche Oberflächenstrukturen voraus, an die die Bakteriophagen binden müssen. „Zwischen S. epidermidis und S. aureus verhindern die unterschiedlichen Zellwandstrukturen normalerweise den Gentransfer. Doch bei den S. epidermidis-Stämmen, die auch die Wandteichonsäuren von S. aureus herstellen können, ist so ein Genaustausch plötzlich möglich“, sagt Peschel. So ließe sich erklären, wie S. epidermidis eine Resistenz gegen Methicillin auf den noch bedrohlicheren – dann Methicillin-resistenten – S. aureus übertragen konnte.
Das müsse jedoch noch genauer untersucht werden. Die neuen Ergebnisse seien ein wichtiger Schritt, um bessere Therapien oder Impfungen gegen gefährliche Krankheitserreger wie den seit rund 15 Jahren bekannten S. epidermidis ST 23 entwickeln zu können, der zur Gruppe der HA-MRSE gehört (healthcare-associated methicillin-resistant S. epidermidis).



Prof. Dr. Andreas Peschel
Universität Tübingen
Exzellenzcluster „Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen“ (CMFI)
Interfakultäres Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin Tübingen (IMIT)
Telefon +49 7071 29-74636
andreas.peschel[at]uni-tuebingen.de
Antje Karbe Eberhard Karls Universität Tübingen
Wilhelmstr. 5
72074 Tübingen
Deutschland
Baden-Württemberg
E-Mail-Adresse: antje.karbe@uni-tuebingen.de
Originalpublikation:
Xin Du, Jesper Larsen, Min Li, Axel Walter, Christoph Slavetinsky, Anna Both, Patricia M. Sanchez Carballo, Marc Stegger, Esther Lehmann, Yao Liu, Junlan Liu, Jessica Slavetinsky, Katarzyna A. Duda, Bernhard Krismer, Simon Heilbronner, Christopher Weidenmaier, Christoph Mayer, Holger Rohde, Volker Winstel, Andreas Peschel: Staphylococcus epidermidis clones express Staphylococcus aureus-type wall teichoic acid to shift from commensal to pathogen behavior. Nature Microbiology, https://doi.org/10.1038/s41564-021-00913-z