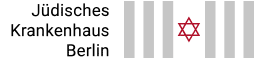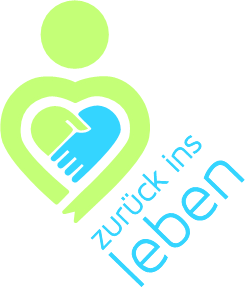Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: TU Berlin und Charité untersuchen Aerosolausbreitung in ÖPNV-Fahrzeugen
Gute Luft in Bus und Bahn
TU Berlin und Charité untersuchen im Auftrag der BVG quantitativ Aerosolausbreitung in ÖPNV-Fahrzeugen ● Lüftung sowie geöffnete Fenster und Türen reduzieren Aerosolkonzentration in den unterschiedlichen Fahrzeugtypen um bis zu 80 Prozent ● Trennscheiben in den Bussen verhindern effektiv die Ausbreitung der Aerosole vom Fahrgastraum zum Fahrerarbeitsplatz ●
Zusätzlicher Positiveffekt von Masken nicht Teil
der Untersuchung
Die Fahrt mit den Öffentlichen in Berlin bleibt auch während der
Corona-Pandemie sicher – für Fahrgäste und Fahrpersonal. Das belegt eine
aktuelle Studie des Fachgebiets Experimentelle Strömungsmechanik der
Technische Universität Berlin sowie des Labors für Biofluidmechanik der
Charité – Universitätsmedizin Berlin. Ein Team von Wissenschaftler*innen
um Prof. Dr.-Ing. Christian Oliver Paschereit und PD Dr.-Ing. Ulrich
Kertzscher hatten im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
experimentell die Ausbreitung von Aerosolen in verschiedenen Berliner
U-Bahnen, Trams und Bussen untersucht.
Hierfür nutzten die Forscher*innen künstlichen Theaternebel sowie
Aerosolmessungen, bei denen virenbehaftete Atemluft simuliert und von
menschenähnlichen Puppen eingeatmet wird. So konnten sie feststellen,
dass die Fahrzeuglüftung sowie das gezielte Öffnen von Fenstern und
Türen für eine effektive Reduktion der Aerosolkonzentration um bis zu 80
Prozent sorgen.
- Bei der Untersuchung nicht einbezogen wurde der zusätzliche, positive Einfluss von medizinischen Masken, wie sie derzeit von den Fahrgästen getragen werden.
Das Volumen eines Busses zum Beispiel entspricht in etwa dem eines
mittelgroßen Konferenzraumes.
- Das Öffnen der Türen an jeder Haltestelle wäre damit vergleichbar, während einer Besprechung etwa alle eineinhalb Minuten die Fenster zu öffnen.
- Zusätzlich sind die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr oft nur wenige Minuten in den Fahrzeugen unterwegs.
Prof. Dr.-Ing. Christian Oliver Paschereit, Leiter des Fachgebiets
Experimentelle Strömungsmechanik an der TU Berlin: „Es hat uns sehr
gefreut, dass unsere neu entwickelte Messtechnik dazu beitragen konnte,
die Ausbreitung von Aerosolen im öffentlichen Nahverkehr und damit das
Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV-2 zu beurteilen. Wir konnten hier zeigen,
dass die Belüftungsanlagen als auch das Öffnen der Fenster und Türen
die Aerosolkonzentration in den betrachteten Verkehrsmitteln sehr
deutlich reduzieren.“
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher, Leiter des Labors für Biofluidmechanik an
der Charité: „Es war eine spannende Herausforderung, unser Messsystem
in den verschiedenen Fahrzeugtypen im Fahrbetrieb einzusetzen. Dass die
Messergebnisse so positiv ausgefallen sind, hat uns tatsächlich
überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut.
Wie erwartet müssen
Maßnahmen ergriffen werden, aber das Öffnen der Fenster und Türen in
Kombination mit den Belüftungsanlagen in den Bussen und Zügen reduzieren
die Aerosolausbreitung deutlich.“
Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG): „Es freut mich sehr, dass diese Studie nun allen unseren
Fahrgästen und Mitarbeiter*innen bestätigt:
Die Nutzung von Bussen und
Bahnen stellt kein erhöhtes Ansteckungsrisiko dar. Mit Maske, Abstand
und guter Lüftung sind wir weiterhin gemeinsam sicher unterwegs.“
Dr. Manuela Huetten, leitende Betriebsärztin und Pandemiebeauftragte der
BVG:
„Es war uns ein besonderes Anliegen, dass auch die Wirksamkeit der Trennscheiben in unseren Bussen unter Corona-Aspekten wissenschaftlich überprüft wird.
Anders als bei U-Bahn und Tram sitzen unsere Fahrpersonale in unseren Bussen nicht in einer Kabine.
- Die Studie zeigt, dass die neu eingebauten Trennscheiben effektiv die Ausbreitung von Aerosolen aus dem Fahrgastraum zum Fahrpersonal verhindern und dieses gut abschirmen.
- In Kombination mit der Fahrerraumlüftung ergibt sich so aus arbeitsmedizinischer Sicht ein Höchstmaß an Sicherheit am Arbeitsplatz.“
- Trotz einer Nachfrage von aktuell nur rund 45 Prozent der vergleichbaren Vor-Corona-Zeiträume fahren Busse und Bahnen der BVG weiterhin das volle Angebot, im Schülerverkehr und auf einer Reihe von Buslinien sogar mit zusätzlichen Leistungen.
So ist besonders viel Platz in den Fahrzeugen.
Dort, wo technisch möglich, öffnen die Türen der Züge und Busse an allen Haltestellen automatisch.
Die Erkenntnisse aus der Studie
werden nun genutzt, um Lüftung und Fensteröffnung in den einzelnen
Fahrzeugen noch gezielter zur Reduktion von möglichen
Aerosolkonzentrationen einzusetzen.
Die Fahrgäste in Bus und Bahn sind durch medizinische Masken und
regelmäßigen Luftaustausch geschützt.
Als erstes Bundesland hatte Berlin im April 2020 zur Eindämmung der Corona-Pandemie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend gemacht.
Seit Januar 2021 ist eine medizinische Maske vorgeschrieben, etwa
OP-Masken oder Masken nach dem FFP2- oder KN95-Standard.
Im Juli 2020 führte die BVG als erstes Nahverkehrsunternehmen
Deutschlands eine von behördlichen Bußgeldern unabhängige Vertragsstrafe
in Höhe von 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein.
Mit
täglich zwischen rund 97 und 99 Prozent ist die „Maskendisziplin“ der
Berliner Fahrgäste bereits seit Monaten erfreulich hoch.
Über Google: Medizin am Abend Berlin
Prof. Dr. Christian Oliver Paschereit
FG Experimentelle Strömungsmechanik, Technische Universität Berlin
Telefon: +49 30 314-79777
E-Mail: oliver.paschereit@tu-berlin.de
http://www.fd.tu-berlin.de
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
Labor für Biofluidmechanik, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Telefon: +49 30 450553818
E-Mail: ulrich.kertzscher@charite.de
https://biofluidmechanik.charite.de/
Stefanie Terp
Technische Universität Berlin