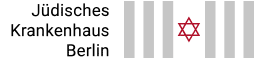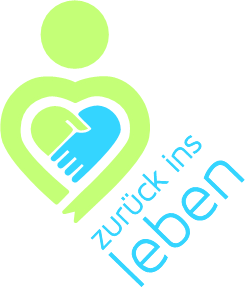Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Am Herzen operierte Babys erholen sich mit Stickstoffmonoxid nicht besser
- Bei Herzoperationen von Babys wird der Herz-Lungen-Maschine vermehrt Stickstoffmonoxid als Entzündungshemmer beigefügt.
Nun zeigt sich in der weltweit grössten Studie von Forschenden der Universität Zürich und ihrer Partneruniversität Queensland:
Die operierten Kinder erholen sich nicht besser, wenn Stickstoffmonoxid verwendet wird.
Etwa eines von hundert Babys leidet an einem angeborenen Herzfehler.
Allein in den USA werden jedes Jahr etwa 40000 Kinder mit angeborenen Herzfehlern geboren.
Bei etwa der Hälfte dieser Kinder ist in den ersten Lebensjahren eine Herzoperation erforderlich.
Dabei wird ein kardiopulmonaler Bypass eingesetzt, eine künstliche Herz-Lungen-Maschine.
Kinder, die am Herz operiert wurden, leiden oft mehrere Tage lang an einer schweren Entzündung als Reaktion auf die Herz-Lungen-Maschine.
Diese Entzündung schwächt das Herz und führt zu Organfehlfunktionen, so dass die Kinder auf der Intensivstation beatmet werden müssen.
Um diese Nebenwirkungen zu vermeiden, wird die Beigabe
von Stickstoffmonoxid in die Herz-Lungen-Maschine als vielversprechende
Methode diskutiert.
Gleich lange Beatmung nach der Operation
Forschende der Universität Zürich, des Kinderspitals und der
Partneruniversität Queensland in Australien haben nun untersucht, ob die
Zugabe von Stickstoffmonoxid zu künstlichen Herz-Lungen-Maschinen den
Beatmungsbedarf bei Kleinkindern nach einer Operation verringert.
«An der randomisierten Studie nahmen 1371 Kinder in sechs Zentren für
Kinderherzchirurgie in Australien, Neuseeland und den Niederlanden
teil», sagt Hauptautor Luregn Schlapbach vom Kinderspital Zürich.
Es zeigte sich, dass die kleinen Patienten, die Stickstoffmonoxid erhielten, nach der Operation gleich lang beatmet werden mussten wie diejenigen ohne.
Die Autoren der UZH und der University of Queensland
kommen daher zu dem Schluss, dass die Verwendung von Stickstoffmonoxid
im kardiopulmonalen Bypass die Erholung nach einer Herzoperation bei
kleinen Kindern nicht verbessert.
Weltweit grösste Studie
Es handelt sich um die weltweit grösste Interventionsstudie bei Kindern
mit Herzfehlern.
«Diese grosse Kohorte wird nun weiter analysiert auch auf der Ebene der Genexpression, um besser zu verstehen, wie in Zukunft die Behandlung weiter verbessert werden kann – auch im Hinblick auf personalisierte Medizin» sagt Schlapbach.
Ebenfalls wir eine Folgestudie mit den untersuchten Kindern bis ins Schulalter durchgeführt, um die langfristigen Auswirkungen der Stickoxidgas-Intervention zu verstehen.
Eines von hundert Babys leidet an einem angeborenen Herzfehler. Kispi Zürich
Luregn Schlapbach
Chefarzt Intensivmedizin und Neonatologie
Kinderspital Zürich
Tel. +41 44 266 37 90
E-Mail: luregn.schlapbach@kispi.uzh.ch
Beat Müller Universität Zürich
Seilergraben 49
8001 Zürich
Schweiz
Zürich
Fax: (0041) 44-634 2346
E-Mail-Adresse: beat.mueller@kommunikation.uzh.ch
Originalpublikation:
Schlapbach LJ, Gibbons KS, Horton SB, et al. Effect of nitric oxide via cardiopulmonary bypass on ventilator-free days in young children undergoing congenital heart disease surgery: the NITRIC randomized clinical trial. Juni 27, 2022. JAMA. DOI: doi:10.1001/jama.2022.9376