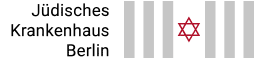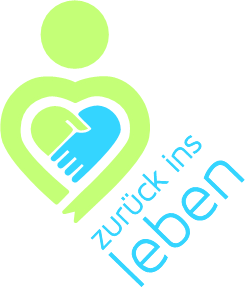Medizin am Abend Berlin Fazit: B-Zellen sind mitverantwortlich für Hirnschäden bei MS
Ein Forscherteam von UZH und USZ weist nach, dass bei Multipler Sklerose nicht allein bestimmte T-Zellen zu den Entzündungen und Schädigungen im Gehirn führen.
Mitverantwortlich ist auch ein anderer Typ von Abwehrzellen: B-Zellen.
Diese aktivieren im Blut die T-Zellen.
Die Entdeckung erklärt, wie neue MS-Medikamente wirken und eröffnet neue Therapieoptionen.
Bei der Multiplen Sklerose greift das Immunsystem die Myelinhülle der Nervenfasern an (weiss). Ralwel/iStockphoto
- Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems.
- Körpereigene Abwehrzellen greifen die Isolationsschicht der Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark an und schädigen sie.
Dadurch wird die Signalübertragung zwischen den Nerven gestört. Die Krankheit, die weltweit rund 2,5 Millionen Menschen betrifft, bricht meist bei jungen Erwachsenen aus. Frauen sind besonders häufig betroffen.
- MS kann zu schwerwiegenden neurologischen Behinderungen wie Gefühlsstörungen, Schmerzen und Lähmungserscheinungen führen.
B-Zellen aktivieren T-Zellen
Ein Team der Universität Zürich (UZH), des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des schwedischen Karolinska Instituts unter der Leitung von Neurologe Roland Martin und Immunologin Mireia Sospedra hat nun einen entscheidenden Aspekt in der Entstehung und Entwicklung von MS entschlüsselt. «Wir konnten erstmals zeigen, dass bestimmte B-Zellen – die antikörperproduzierenden Zellen des Immunsystems – jene T-Zellen aktivieren, die die Entzündung im Gehirn und die Schädigung der Nervenzellen auslösen», sagt Roland Martin, Leiter des Klinischen Forschungsschwerpunkts Multiple Sklerose der UZH.
Neue MS-Medikamente greifen B-Zellen an
Bis vor Kurzem konzentrierte sich die MS-Forschung vor allem auf die T-Zellen, die sogenannten T-Helfer-Lymphozyten. Sie sind die Wächter der Immunabwehr, die beispielsweise bei Infektionen mit Viren oder Bakterien Alarm schlagen.
Bei etwa jeder tausendsten Person gerät die Fähigkeit der zellulären Aufpasser, zwischen körpereigenen und fremden Strukturen zu unterscheiden, durcheinander.
Resultat ist, dass die fehlgeleiteten T-Zellen das eigene Nervengewebe attackieren – der Beginn von MS.
Allerdings sind die T-Zellen nicht allein verantwortlich.
«Auf die Spur, dass auch die B-Zellen eine wichtige Rolle in der Pathogenese spielen, führte uns eine Klasse von MS-Medikamenten namens Rituximab und Ocrelizumab», erläutert Roland Martin.
Diese beseitigen die B-Zellen, was die Hirnentzündung und die Krankheitsschübe der Patienten sehr wirksam hemmt.
Rolle der B-Zellen als «Mittäter» entlarvt
Die konkrete Rolle der B-Zellen ermittelten die Forschenden mit Hilfe eines experimentellen In-vitro-Systems, mit dem Blutproben untersucht werden können. Im Blut von MS-Betroffenen zeigte sich eine erhöhte Aktivierung und Zellteilung jener T-Zellen, die sich gegen die körpereigenen Nervenfaserhüllen richten. Auslöser waren B-Zellen, die mit den T-Zellen interagieren.
Wurden die B-Zellen eliminiert, hemmte dies sehr wirksam die T-Zellvermehrung.
«Damit», so Martin, «ist es uns gelungen, den bisher noch unklaren Wirkmechanismus dieser MS-Medikamente zu entschlüsseln.»
- Aktivierte T-Zellen wandern ins Gehirn
- Das Team entdeckte zudem, dass sich unter den aktivierten T-Zellen im Blut insbesondere solche befinden, die bei Krankheitsschüben von MS-Patienten auch im Gehirn auftreten.
- Vermutlich sind sie für die Entzündungsherde verantwortlich.
Weitere Untersuchungen zeigten, dass diese T-Zellen Strukturen eines Proteins erkennen, das sowohl von den B-Zellen wie auch von Nervenzellen im Gehirn produziert wird.
Nach der Aktivierung im peripheren Blut wandern die T-Zellen ins Gehirn ein, wo sie das Nervengewebe zerstören.
«Unsere Resultate erklären nicht nur, wie die neuen MS-Medikamente wirken, sondern bahnen auch den Weg für neue Ansätze in der MS-Grundlagenforschung und -therapie», folgert Roland Martin.
Finanzierung
Das Forschungsprojekt wurde massgeblich vom «ERC Advanced Grant» des Europäischen Forschungsrates unterstützt. Weitere Mittel stammen vom Klinischen Forschungsschwerpunkt Multiple Sklerose der UZH, der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft, dem Schweizerischen Nationalfonds sowie mehreren schwedischen Förderinstrumenten.
B-Zellen sind mitverantwortlich für Hirnschäden bei MS
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Prof. Dr. med. Roland Martin
Klinik für Neurologie
Universitätsspital Zürich
Tel. +41 44 255 11 25
E-Mail: roland.martin@usz.ch
Seilergraben 49
8001 Zürich
Schweiz
Zürich
Kurt Bodenmüller
Telefon: +41446344439
Fax: +41446342346
E-Mail-Adresse: kurt.bodenmueller@kommunikation.uzh.ch