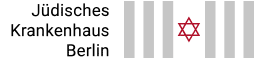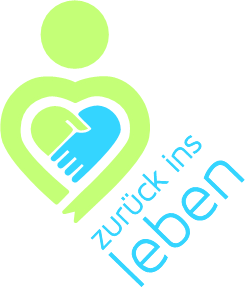Medizin am Abend Berlin Fazit: Gebührenfreie Kita: Was kostet das die öffentliche Hand? DJI/TU Dortmund geben Schätzung ab
In der politischen Öffentlichkeit wird derzeit die Abschaffung der Kita-Gebühren diskutiert.
Nach aktuellen Berechnungen wurden 2015 von den Eltern schätzungsweise 3,8 Milliarden EUR für die Nutzung von Kitas und Kindertagespflege ausgegeben.
Zusätzlich wenden die Bundesländer für Beitragsbefreiungen mehr als 550 Millionen EUR im Jahr auf.
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Berechnung, die vom Forschungsverbund DJI/TU Dortmund erstellt wurde.
„Bei dem Thema Befreiung von Kita-Gebühren ist es wichtig, auch über eine seriöse Datengrundlage zu verfügen, damit eine realistische Folgenabschätzung möglich wird“, so der Direktor des Deutschen Jugendinstituts, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach.
- In Deutschland existieren keine einheitlichen Kriterien und Verfahren bei der Erhebung der Kita-Gebühren.
- In Düsseldorf können Eltern von Kindern zwischen drei Jahren bis zum Schuleintritt beispielsweise ihre Kinder umsonst in die Kita schicken; in anderen Bundesländern wie Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind Kinder ab einem bestimmten Alter oder Betreuungsumfang von Gebühren befreit.
Die geschätzte Gesamtsumme von über 4,4 Mrd. Euro, die von Eltern und Ländern 2015 insgesamt gezahlt wurde, setzt sich zusammen aus:
• 1,36 Mrd. Euro Elternbeiträgen bei öffentlichen Trägern;
• 2,47 Mrd. Euro Elternbeiträgen bei freien Trägern und
• 0,55 Mrd. Euro Landeszuschüssen.
„Ich gehe davon aus, dass die Elternbeiträge in der Summe seit 2015 weiter gestiegen sind, inzwischen also schon höher liegen als wir das mit amtlichen Daten abbilden können“, vermutet Prof. Dr. Thomas Rauschenbach.
So seien in einigen Ländern und Kommunen die Kita-Gebühren
erhöht worden.
- Außerdem sei die Zahl der betreuten Kinder durch die Bevölkerungsentwicklung, insbesondere auch durch den Geburtenanstieg und die Zuwanderung von geflüchteten Kindern, wieder gestiegen.
Hinzu komme, dass immer mehr Eltern von unter Dreijährigen ihre Kinder in einer Kita betreuen lassen möchten – Tendenz steigend. 2016 wünschten sich schon 46 Prozent der Eltern einen Platz für ihre Kleinkinder.
Literatur
Christiane Meiner-Teubner (2017): Gebührenfreie Kita – was kostet das? Eine Abschätzung zur Höhe der gezahlten Elternbeiträge. Dortmund/München
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Christiane Meiner-Teubner
Technische Universität Dortmund
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund
Tel. 0231 755-8188
christiane.meiner@tu-dortmund.de
Dr. Felicitas von Aretin
Deutsches Jugendinstitut
Abteilungsleitung
Medien und Kommunikation
Tel. 089 62306-258
aretin@dji.de
Susanne John Deutsches Jugendinstitut e.V.
Nockherstraße 2
81541 München
Postfach 900352
81503 München
Deutschland
Bayern
Susanne John
E-Mail-Adresse: john@dji.de