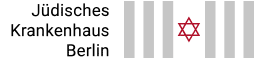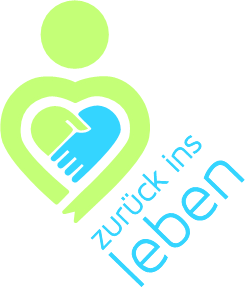Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Auch Alltagsaktivitäten steigern das Wohlbefinden
Körperliche Aktivität macht glücklich und ist wichtig, um auch psychisch gesund zu bleiben.
Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim untersuchten, welche Hirnregionen dabei eine zentrale Rolle spielen.
- Die Ergebnisse zeigen, dass schon Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen einen deutlichen Nutzen für das Wohlbefinden haben, insbesondere auch bei Menschen, die anfällig für psychiatrische Erkrankungen sind.
Die aktuelle Studie ist in der Zeitschrift Science Advances erschienen (DOI: 10.1126/sciadv.aaz8934).
Selbst Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen können sich positiv auf
das seelische Wohlbefinden auswirken. (Foto: Markus Breig, KIT) Markus Breig, KIT
Körperliche Aktivität macht glücklich und ist wichtig, um auch psychisch gesund zu bleiben. Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim untersuchten, welche Hirnregionen dabei eine zentrale Rolle spielen.
Die Ergebnisse zeigen, dass schon
Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen einen deutlichen Nutzen für das
Wohlbefinden haben, insbesondere auch bei Menschen, die anfällig für
psychiatrische Erkrankungen sind. Die aktuelle Studie ist in der
Zeitschrift Science Advances erschienen (DOI: 10.1126/sciadv.aaz8934).
Bewegung verbessert das körperliche Wohlbefinden und die geistige
Gesundheit erheblich.
Wie sich schon alltägliche Aktivitäten wie Treppensteigen, Spazierengehen oder Zur-Straßenbahn-Laufen auf die eigene Befindlichkeit auswirken, war bisher wenig untersucht worden. Unklar ist bis jetzt insbesondere, welche Gehirnstrukturen daran beteiligt sind. Ein Forschungsteam am Zentralinstitut für Bewegung verbessert das körperliche Wohlbefinden und die geistige Gesundheit erheblich. Wie sich schon alltägliche Aktivitäten wie Treppensteigen, Spazierengehen oder Zur-Straßenbahn-Laufen auf die eigene Befindlichkeit auswirken, war bisher wenig untersucht worden. Unklar ist bis jetzt insbesondere, welche Gehirnstrukturen daran beteiligt sind. Ein Forschungsteam am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim, am Institut für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) des KIT und am Geoinformatischen Institut der Universität Heidelberg fokussierte in seiner Studie Alltagsaktivitäten, die den größten Anteil unserer täglichen Bewegung ausmachen.
„Schon das alltägliche Treppensteigen kann
helfen, sich wach und energiegeladen zu fühlen und damit das
Wohlbefinden zu steigern“, erläutern die beiden Erstautoren der Studie,
Dr. Markus Reichert, der am ZI in Mannheim und am KIT forscht, und Dr.
Urs Braun, Leiter der Arbeitsgruppe Komplexe Systeme in der Psychiatrie
am ZI.
Besondere Relevanz haben die Forschungsergebnisse gerade in der
derzeitigen Situation mit Corona-Beschränkungen und dem bevorstehenden
Winter. „Aktuell leiden wir unter starken Einschränkungen des
öffentlichen Lebens und unserer sozialen Kontakte, was sich auf unser
Wohlbefinden niederschlagen kann“, so Professorin Heike Tost, Leiterin
der Arbeitsgruppe Systemische Neurowissenschaften in der Psychiatrie am
ZI und eine der zentralen Autorinnen der Studie, „da kann es helfen,
öfter mal Treppen zu steigen, um sich besser zu fühlen.“
Alltagsaktivitäten steigern „Wachheit“ und „Energiegeladenheit“
„Die Untersuchungen wurden durch eine neuartige Kombination
verschiedener Forschungsmethoden im Alltag und im Labor möglich“, so
Professor Ulrich Ebner-Priemer, Leiter der Arbeitsgruppe mHealth
Methoden in der Psychiatrie am ZI Mannheim sowie stellvertretender
Leiter des IfSS und Leiter des Mental mHealth Lab am KIT. Eingesetzt
wurden Alltagserhebungsverfahren (sogenannte Ambulante Assessments) mit
Bewegungssensoren und Smartphone-Abfragen zum Wohlbefinden, die anhand
von Geolokalisationsdaten ausgelöst wurden, sobald sich die
Studienteilnehmer bewegten.
Mit diesen Alltagserhebungsverfahren wurde bei 67 Personen der Einfluss
der Alltagsaktivität auf die Wachheit und Energiegeladenheit über sieben
Tage hinweg erfasst. Dabei zeigte sich, dass sie sich direkt nach
alltäglicher Aktivität wacher und energiegeladener fühlten. Wachheit und
Energiegeladenheit wiederum waren nachweislich wichtige Komponenten des
Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit der Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer.
Gehirnareale für Alltagsbewegung und Wohlbefinden identifiziert
Kombiniert wurden diese Analysen bei einer weiteren Gruppe von 83
Personen mit Magnetresonanztomografie am ZI. Dabei wurde das Volumen der
grauen Hirnsubstanz vermessen, um herauszufinden, welche Areale im
Gehirn für diese Alltagsprozesse eine Rolle spielen. Wichtig für das
Zusammenspiel von Alltagsbewegung und affektivem Wohlbefinden ist ein
Bereich der Großhirnrinde, der subgenuale Anteil des Anterior Cingulären
Cortex. Diese Hinrnregion spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation
von Emotionen und der Widerstandsfähigkeit gegenüber psychiatrischen
Erkrankungen. Von den Autorinnen und Autoren der Studie wurde diese
Hirnregion nun als ein entscheidendes neuronales Korrelat identifiziert,
das den Zusammenhang von körperlicher Aktivität und subjektiver
Energiegeladenheit vermittelt. „Personen, die ein geringeres Volumen an
grauer Hirnsubstanz in dieser Region aufwiesen und ein erhöhtes Risiko
haben, an psychiatrischen Erkrankungen zu leiden, fühlten sich
einerseits weniger energiegeladen, wenn sie körperlich inaktiv waren“,
beschreibt Heike Tost die Ergebnisse, „aber andererseits nach
alltäglicher Bewegung deutlich energiegeladener als Personen mit
größerem Hirnvolumen.“
Spezifischer Nutzen von körperlicher Aktivität im Alltag
Professor Andreas Meyer-Lindenberg, Vorstandsvorsitzender des ZI und
Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
schlussfolgert, dass „die Ergebnisse damit auf einen spezifischen Nutzen
von körperlicher Aktivität im Alltag für das Wohlbefinden hinweisen,
insbesondere bei Menschen, die anfällig für psychiatrische Erkrankungen
sind.“ Zukünftig könnten die in der Studie gewonnen Ergebnisse im Alltag
dazu führen, dass eine auf dem Smartphone installierte App bei
sinkender Energie die Nutzer zu Bewegung stimulieren soll, um das
Wohlbefinden zu steigern. „Langfristig ist in Studien zu klären, ob sich
durch Alltagsbewegung kausal das Wohlbefinden und das Hirnvolumen
verändern lassen und inwieweit diese Ergebnisse helfen könnten,
psychiatrische Erkrankungen zu vermeiden und zu therapieren,“ so Urs
Braun.
Originalpublikation:
Markus Reichert, Urs Braun, Gabriela Gan, Iris Reinhard, Marco Giurgiu,
Ren Ma, Zhenxiang Zang, Oliver Hennig, Elena Koch, Lena Wieland, Janina
Schweiger, Dragos Inta, Andreas Hoell, Ceren Akdeniz, Alexander Zipf,
Ulrich Ebner-Priemer, Heike Tost and Andreas Meyer-Lindenberg: A neural
mechanism for affective well-being: Subgenual cingulate cortex mediates
real-life effects of nonexercise activity on energy. Science Advances,
2020. DOI: 10.1126/sciadv.aaz8934
Weitere Materialien:
Zur Publikation in Science Advances: https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaaz8934
Dr. Sabine Fodi
Tel.: +49 721 608-41154
E-Mail: sabine.fodi@kit.edu
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe
Deutschland
Baden-Württemberg
Monika Landgraf
Telefon: 0721 / 608 – 21105
Fax: 0721 / 608 - 43658
E-Mail-Adresse: monika.landgraf@kit.edu
Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“ schafft
und vermittelt das KIT Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es,
zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern
Energie, Mobilität und Information zu leisten. Dazu arbeiten rund 9 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis
in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und
Sozialwissenschaften zusammen. Seine 24 400 Studierenden bereitet das
KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium auf
verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und
Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT schlägt die Brücke
zwischen Erkenntnis und Anwendung zum gesellschaftlichen Nutzen,
wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen. Das KIT ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten.