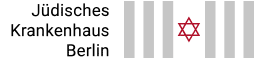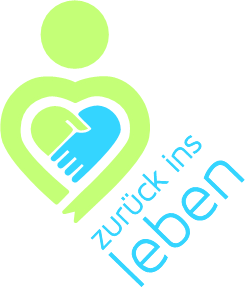Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Corona-Pandemie: Statistische Konzepte und ihre Grenzen
Noch ist ungewiss, wie sich die COVID 19-Pandemie weiter entwickeln
wird.
Die „Unstatistik des Monats“ möchte in der aktuellen Situation
helfen, zumindest bezüglich statistischer Konzepte etwas Licht ins
Dunkel zu bringen.
Daher gibt es keine übliche Unstatistik, stattdessen
werden wesentliche Konzepte und deren Grenzen erklärt. [...]
Hinsichtlich von Statistiken gilt derzeit das Prinzip, sich beim Fahren
auf Sicht durch die skizzierten Modellrechnungen leiten, sich von
Einzelinformationen jedoch nicht zu sehr beeindrucken zu lassen.
Die Schätzung der Verbreitungs-Raten
Bei
Pandemien kommt es
üblicherweise zu einem exponentiellen Wachstum
der Zahl der Infizierten, da jeder Infizierte andere Personen infiziert,
die
im Sinne eines Schneeballeffekts wiederum andere Personen
infizieren.
- Exponentielles Wachstum ist somit durch konstante
Wachstumsraten und nicht nur durch konstante absolute Zuwächse
gekennzeichnet.
- Es führt daher unweigerlich dazu, dass sich die Zahl der
Infizierten in einem bestimmten Zeitraum verdoppelt.
- Ist dieser
Zeitraum kurz, wird die absolute Anzahl der Infizierten rasch sehr groß,
unabhängig davon, ob man von einer kleinen oder von einer etwas
größeren Ausgangsbasis aus startet.
Kennt man die grundlegenden Eigenschaften des Krankheitsbilds, kann man
die Entwicklung einer Pandemie ziemlich genau prognostizieren.
Im
Wesentlichen geht es dabei um drei Faktoren:
- Erstens ist entscheidend,
wie viele Menschen eine infizierte Person typischerweise ansteckt (der
sogenannte Reproduktionsfaktor). Dieser Faktor hängt nicht nur vom Virus
ab, sondern auch von unserem Kontaktverhalten.
- Zweitens ist für diesen
Reproduktionsfaktor von zentraler Bedeutung, wie lange eine infizierte
Person ansteckend ist.
- Drittens entscheidet die Frage, ob nach dem
Durchstehen der Krankheit eine Immunität eintritt oder nicht, ebenfalls
über die Zahl der möglichen Neuinfektionen.
Auf Basis einer Einschätzung dieser Faktoren kann man die exponentielle
Ausbreitung einer derartigen Pandemie in der Bevölkerung recht
verlässlich abschätzen.
Wir beobachten seit dem 15. März
eine tägliche
Wachstumsrate der Infizierten von ca. 23 Prozent, d.h. die Zahl der
Infizierten verdoppelt sich alle 3 Tage. Verwendet man allein zum Zweck
der Verdeutlichung ein exponentielles Wachstumsmodell und startet man
mit 6.000 Infizierten (ca. die Anzahl der Infizierten am 15. März),
wären innerhalb von 14 Tagen knapp 109.000 Personen infiziert,
nach 30
Tagen nahezu 3 Millionen.
Es ist wiederum offensichtlich, dass diese Entwicklung
die Kapazitäten
der Gesundheitsversorgung schnell ausreizen dürfte, selbst wenn nur ein
sehr geringer Anteil an
Infizierten einen schweren Krankheitsverlauf
zeigt, der zu einer Behandlung auf einer Intensivstation zwingt oder
ansonsten lebensbedrohlich verläuft. So wären beispielsweise bei 1,5
Million Infizierten und einem Anteil schwerer Verläufe von nur 3% die in
Deutschland verfügbaren Intensivkapazitäten selbst dann schon bei
weitem ausgereizt, wenn man dort keinerlei andere schwere Fälle zu
behandeln hätte. Eine Rationierung von Intensivkapazitäten nicht mehr
vermeiden zu können, bedeutet somit im Klartext, eine Vielzahl von
Todesfällen hinnehmen zu müssen.
Somit wird, solange es keinen Impfstoff gibt, der Reproduktionsfaktor
zur entscheidenden Stellschraube einer jeden denkbaren Abwehrstrategie.
Sobald dieser Faktor auf den Wert 1 sinkt, wird die Anzahl der
Neuinfektionen bei dem dann erreichten Stand stabilisiert, fällt er
darunter, geht diese Anzahl wieder zurück. Ließen sich einzelne Fälle
von Infizierten sofort trennscharf erkennen, dann wäre es
vergleichsweise leicht zu organisieren, dass diese Infizierten isoliert
und ihre direkten Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt werden. Der
Reproduktionsfaktor würde dann voraussichtlich rasch sinken, es könnte
eine (wachsame) Form der Normalität einkehren.
Im Augenblick steht diese Lösung aber nicht im Ansatz zur Verfügung, die
entsprechenden Testkapazitäten und die Verfahren zur Umsetzung dieser
Strategie müssen erst aufgebaut werden (eine entsprechende
online-Petition von „Unstatistikerin“ Katharina Schüller, um dies zu
beschleunigen, findet sich hier).
Somit bleibt im Augenblick nur die
wenig trennscharfe und für unser Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
schmerzhafte Strategie, durch eine generelle Verringerung der direkten
sozialen Kontakte die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Wenn die
Bevölkerung dabei
diszipliniert mitwirkt, können die mathematischen
Gesetze des exponentiellen Wachstums somit helfen, die Ausbreitung stark
zu bremsen. In obigem Beispiel würde eine Halbierung der täglichen
Wachstumsrate auf 12 Prozent lediglich zu knapp 30 Tausend Infizierten
nach 14 Tagen und 180 Tausend Infizierten nach 30 Tagen führen. Je
konsistenter wir alle uns die Hände waschen, Distanz halten und andere
hygienisches Maßnahmen ergreifen, desto geringer wird die Wachstumsrate.
Das alles sind natürlich nur Beispielrechnungen. Aktuell gibt es zu
allen drei oben genannten Faktoren im Falle von COVID-19 keine völlig
trennscharfen Informationen, denn wir betreten damit notgedrungen
Neuland. Die Statistik, die Epidemiologie und virologische Expertise
sind somit gleichermaßen nötig, um aus den neu eintreffenden Daten
zumindest grobe Schätzungen in Echtzeit abzuleiten, um so die
Ausbreitung der Pandemie und die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen zu
beurteilen. Wie viele Neuinfektionen in den kommenden Tagen zu erwarten
sind, können selbst Experten aufgrund der unsicheren Datenlage nicht
verlässlich prognostizieren. Dazu sind die Spannbreiten, innerhalb derer
die unbekannten Parameter liegen können, viel zu groß.
Und doch reichen diese Beispielrechnungen völlig aus, um ein
entschlossenes politisches Handeln zu begründen, das der Eindämmung der
Neuinfektionen aktuell die absolute Priorität zuweist. So zeigen
Modellrechnungen sowohl des Robert-Koch-Instituts als auch der Deutschen
Gesellschaft für Epidemiologie eindeutig, dass es für die Frage, ob
diese Strategie zu ergreifen ist, unerheblich ist, ob die
Reproduktionsrate nun in der Realität bei 2,5 oder bei 1,5 liegt, oder
ob kleinere Veränderungen der weiteren für den Einsatz dieser Modelle
notwendigen Annahmen vorgenommen werden: Wird der Reproduktionsfaktor
nicht rasch in Richtung des Wertes 1 gedrängt, wird das deutsche
Gesundheitssystem innerhalb kürzester Zeit kollabieren. Es geht dann nur
noch um die Frage nach der Anzahl der Wochen, bis dieser Punkt erreicht
ist. Dies kann nur jetzt noch verhindert werden.
Die Einordnung der Fallzahlen
Die Dynamik von Infektionskrankheiten weist zwischen der ursprünglichen
Ansteckung und der Ausprägung von Symptomen üblicherweise eine
Inkubationszeit auf und verhindert so nicht nur, dass man die
Infizierten ohne ein ausgeprägtes System des umfassenden Testens
frühzeitig erkennen und isolieren kann. Sondern sie führt ebenfalls
unweigerlich dazu, dass die Wirksamkeit von Maßnahmen, die heute
eingeleitet werden, erst in einigen Tagen oder gar Wochen sichtbar
werden, und das selbst dann, wenn sie sofort die angestrebte Wirkung
entfalten. Vor allem kann man aus nach wie vor steigenden Fahlzahlen
nicht auf eine mangelnde Wirksamkeit der jetzt angestrengten Maßnahmen
schließen.
Erschwerend kommt hinzu, dass man die Schlussfolgerungen in der
aktuellen Situation auf besonders unsicheres Datenmaterial gründen muss.
So hat die Zahl der getesteten Infizierten nur bedingt etwas mit der
Zahl der tatsächlichen Infizierten zu tun, weil Menschen mit wenigen
oder gar keinen Symptomen bislang in den seltensten Fällen getestet
werden, insbesondere nicht, wenn sie keinen Kontakt zu nachweislich
Infizierten hatten. Erst mit der Entwicklung schnellerer Testverfahren,
die vor wenigen Tagen erstmals in Deutschland zum Einsatz kamen, wird es
möglich werden, systematisch zu testen. Dabei wird es voraussichtlich
regionale Unterschiede geben. Die Anzahl der erfassten Infizierten wird
stark davon abhängen, wie intensiv in den unterschiedlichen Regionen
getestet wird.
Ändert sich nun aufgrund neuer Testverfahren der Anteil der bestätigten
Fälle an allen Infizierten, d.h. der Summe aus bestätigten Fällen und
der nach wie vor nicht erfassten Fälle („Dunkelziffer“), dann können die
gemeldeten Fallzahlen steigen, ohne dass dem eine beschleunigte
Erkrankungsdynamik zugrunde liegt. Die beobachteten Fallzahlen lassen
daher nur bedingt Rückschlüsse darauf zu, ob die in einem Prognosemodell
verwendeten Annahmen über die Ansteckungsraten korrekt waren oder
nicht.
Deshalb unterliegen Mutmaßungen wie im Focus zu den gestiegenen
Fallzahlen der vergangenen Tage vermutlich einem Fehlschluss. Denn durch
Inkubationszeit, Test- und Auswertungsdauer etc. gehen die heutigen
Fallzahlen auf Infektionen von vor 5-10 Tagen zurück. Am Montag
vergangener Woche wurde allerdings ein neues, schnelleres Testverfahren
(CDC-Test) vorgestellt. Mit gutem Grund lässt sich annehmen, dass damit
die Test- und Auswertungsdauer in den darauffolgenden Tagen beschleunigt
wurde und allein deshalb die Zahl der bestätigten Fälle vorübergehend
ansteigt.
Zudem werden in der Berichterstattung immer wieder die aktuellen
Maßnahmen den Fallzahlen gegenübergestellt ("trotz der verschärften
Maßnahmen sind die Fallzahlen auch gestern weiter gestiegen", u.a. im
„heute journal“ oder ähnlich auch bei „Spiegel Online“). Ob die
verschärften Maßnahmen wirken, können wir aber vermutlich frühestens in
ein bis zwei Wochen beurteilen. Insofern muss der Politik die Zeit
gegeben werden, den Erfolg der Maßnahmen zu evaluieren. Die Strategie,
der Ansteckungsdynamik durch eine konsequente Verringerung der sozialen
Kontakte die Spitze zu brechen, sollte nicht durch Frustration über die
ausbleibende Wirkung dieser Maßnahme in Frage gestellt werden, noch
bevor sich diese Wirkung überhaupt erst in den Daten zeigen kann.
Die Fallstricke von Ländervergleichen
Da alle Nationen mehr oder weniger ihre eigene Strategie für den Umgang
mit der Covid-19-Pandemie verfolgen, ist der internationale Vergleich im
Prinzip eine hervorragende Grundlage, um wirksame Strategien zu
identifizieren. Doch dazu reicht es nicht aus, die Entwicklung in
Deutschland derjenigen in anderen Ländern einfach gegenüberzustellen,
ohne die Begrenzungen der Vergleichbarkeit zu bedenken. Insbesondere
hängen die erfassten Fallzahlen in jedem Land zentral davon ab, wie
systematisch und umfangreich dort auf den Virus getestet wird. Ebenso
hängt die nachgewiesene Ausbreitung des Virus aufgrund der geschilderten
exponentiellen Natur des Fallwachstums sehr stark davon ab, wann die
erste Person in einem Land infiziert wurde und wann eine Regierung
Maßnahmen eingeführt hat – und nicht allein von den Maßnahmen selbst.
Darüber hinaus wird in vielen Ländervergleichen immer wieder auf das
Verhältnis der Todesfälle zu den zum jeweiligen Zeitpunkt bestätigt
Infizierten verwiesen bzw. die kumulierten Todesfälle durch die
kumulierten bestätigten Fälle geteilt. Mit diesem Vorgehen wird jedoch
eine falsche Vergleichsgruppe verwendet, und die Tödlichkeit von
COVID-19 wird wiederum aufgrund des exponentiellen Wachstums
unterschätzt. Sinnvoll wäre, die bestätigten Fälle der infizierten
Kohorte, aus der die mutmaßlichen Todesfälle stammen, als
Vergleichsgruppe zu wählen. Der Abgleich der Zeitreihen von bestätigten
Infektionen und Todesfällen aus China und Deutschland lässt den Schluss
zu, dass etwa 11 Tage Verzug das stabilste Verhältnis liefern, d.h. dass
es am plausibelsten ist, den Anteil der Todesfälle an der Zahl der
bestätigten Fälle 11 Tage zuvor zu berechnen.
Wird allerdings die Dunkelziffer nicht berücksichtigt (die wiederum
erheblich vom Ausmaß der durchgeführten Tests abhängt), dann wird der
Nenner der Verhältnisgröße zu klein und damit die geschätzte Letalität –
d.h. der Anteil der Todesfälle an allen neu Infizierten – systematisch
überschätzt. Darüber hinaus variiert die statistische Erfassung der
Todesursachen von Land zu Land erheblich. Es ist schwer festzustellen,
ob eine Person mit dem Virus oder durch den Virus gestorben ist. Wenn
man, wie in vielen Ländern, bei Verstorbenen mit chronischen Krankheiten
und im fortgeschrittenen Alter einen Coronavirus nachträglich
feststellt, wird ein Teil davon nicht durch, sondern mit dem Virus
gestorben sein. Dies führt ebenfalls zu einer Überschätzung der
Todesrate. Insgesamt muss man festhalten, dass eine präzise Schätzung
der Sterblichkeit zum derzeitigen Zeitpunkt nahezu unmöglich ist.
Allerdings gibt es ein natürliches Experiment, das Kreuzfahrtschiff
„Diamond Princess“, bei dem von einer vollständigen Erfassung der
Infizierten auszugehen ist, weil alle Passagiere getestet wurden. Zwar
ist die Besatzung eines Kreuzfahrschiffs älter als die
Durchschnittsbevölkerung, aber diese Altersverschiebung können
Statistiker zumindest näherungsweise herausrechnen. Aus den Daten der
„Diamond Princess“ ergibt sich nach einer Altersstandardisierung dann
eine Sterblichkeit von COVID-19, die bei 0,5% liegt – mit einer
Unsicherheit, die etwa bei +/-50% liegt.
Fazit
Die zur COVID-19-Pandemie bislang vorliegenden Erkenntnisse sind nicht
ausreichend, um deren weitere Verbreitung verlässlich zu
prognostizieren, erst recht nicht unter den Voraussetzungen
unterschiedlicher politischer Maßnahmen zur Eindämmung von
Neuinfektionen. Man sollte die Entwicklung der Pandemie zweifelsohne
weiter detailliert verfolgen, jedoch ohne sich von Einzelinformationen
zu sehr beeindrucken zu lassen. Aufgrund der exponentiell wachsenden
Ausbreitung eines solchen Virus ist vermutlich der beste Fingerzeig auf
eine erste Abschwächung der Problematik eine Verringerung der
Zuwachsraten an mehreren Tagen hintereinander.
Im Augenblick gilt aber das Prinzip, sich beim Fahren auf Sicht durch
die skizzierten Modellrechnungen leiten zu lassen. Denn trotz der Fülle
an Faktoren, die eine verlässliche Prognose der künftigen Verbreitung
verhindern, zeigen Simulationsstudien mit verschiedenen durchaus
realistischen Szenarien sehr klar, dass das deutsche Gesundheitssystem
innerhalb weniger Tage vollständig kollabieren würde, würde die
Reproduktionsraten nicht über eine konsequente Vermeidung sozialer
Kontakte rasch auf einen Wert von 1 reduziert werden. Dabei sollte man
auch nicht jeden Tag panisch neu bewerten, ob die Maßnahmen Wirkung
zeigen oder nicht. Die Wirkung dieser Maßnahme wird sich frühestens in
ein bis zwei Wochen zeigen.
Der Verzögerung der Ausbreitung des Virus kann dem Gesundheitssystem
dann hoffentlich die Zeit verschaffen, notwendige Kapazitäten zur
Behandlung schwerer Fälle auszubauen und – mit etwas längerer
Perspektive – zu Medikamenten und einem möglichen Impfstoff zu forschen.
Vor allem ließe sich dadurch Zeit gewinnen, die Kapazitäten aufzubauen,
um eine Vielzahl von Personen schnell und wiederholt zu testen. Dies
würde die Möglichkeit eröffnen, stufenweise zu einem einigermaßen
normalen Leben zurückzukehren und damit die negativen sozialen und
wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Pandemie einigermaßen zu begrenzen.
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Katharina Schüller (STAT-UP), Tel.: (089) 34077-447
Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Tel.:(0201) 8149-264
Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph M. Schmidt, Tel.: (0201) 8149-213
Sabine Weiler (Kommunikation RWI), Tel.: (0201) 8149-213
Hohenzollernstraße 1-3
45128 Essen
Deutschland
Nordrhein-Westfalen
E-Mail-Adresse:
rwi@rwi-essen.de
Telefon: 0201 / 81 49-213
Fax: 0201 / 81 49-438
E-Mail-Adresse:
sabine.weiler@rwi-essen.de
Mit der „Unstatistik des Monats“ hinterfragen der Berliner Psychologe
Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer, die
STAT-UP-Gründerin Katharina Schüller und RWI-Vizepräsident Thomas K.
Bauer je-den Monat sowohl jüngst publizierte Zahlen als auch deren
Interpretationen. Alle „Unstatistiken“ finden Sie im Internet unter
http://www.unstatistik.de und unter dem Twitter-Account @unstatistik.
Originalpublikation:
http://www.rwi-essen.de/unstatistik/101/
Weitere Informationen für international Medizin am Abend Berlin Beteiligte
http://www.unstatistik.de (Alle „Unstatistiken“ im Internet)