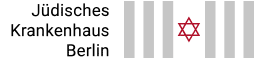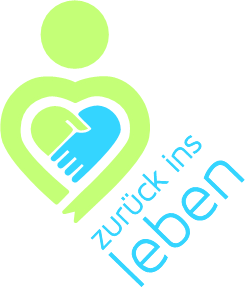Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Entzündungswerte geben Hinweis auf Suizidalität
Chronische Entzündungen und Depressionen könnten eine gemeinsame genetische Ursache haben.
Im Fokus jüngster Forschung steht der Entzündungsmarker Interleukin-6 (IL-6), der sich als potenzieller Risikofaktor für Suizidalität erwiesen hat.
„Wir haben uns die Frage gestellt, ob Entzündungen einen gemeinsamen genetischen Hintergrund mit einzelnen depressiven Symptomen teilen und ob sie sogar für deren Entstehung mitverantwortlich sind“, erklärt Nils Kappelmann vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie (MPI) in München.
Die Wissenschaftler des MPI, der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der University of Cambridge analysierten eine Reihe genetischer Varianten, die unter anderem mit erhöhten Entzündungswerten und dem Body-Maß-Index (BMI) als Marker für Übergewicht und Regulierungsstörungen des Stoffwechsels in Verbindung stehen.
Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal JAMA Psychiatry veröffentlicht.
Das Team konnte die These bestätigen, dass Regulierungsstörungen des Immunsystems und des metabolischen Stoffwechsels eine gemeinsame genetische Basis mit depressiven Symptomen haben.
- So scheint ein hoher BMI ursächlich mit den vier Depressionssymptomen:
- Freud- und Interessenslosigkeit,
- Appetitveränderungen,
- Erschöpfung
- Unzulänglichkeitsgefühlen
- in Zusammenhang zu stehen.
- „Überrascht hat uns außerdem, dass erhöhte Entzündungswerte, speziell Interleukin-6 (IL-6), einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Suizidalität geben“, so Studienleiter Kappelmann. IL-6 spielt bei der Regulation des Immunsystems eine Schlüsselrolle und ist ein Marker für das Entzündungsgeschehen im Körper.
Immuntherapie statt Antidepressiva
Depressionen äußern sich bei Menschen ganz unterschiedlich mit teils
widersprüchlichen Symptomen.
- Eine Subgruppe, die als immuno-metabolische Depression bezeichnet wird und circa ein Viertel aller Patienten umfasst, weist Regulierungsstörungen des Immunsystems und des Stoffwechsels auf.
Diese Patienten sprechen in der Regel schlechter auf klassische Antidepressiva oder Psychotherapie an.
Entzündungshemmer, wie IL-6-hemmende Medikamente, könnten deshalb ein neuer Ansatz zur medikamentösen Therapie der Depression und Prävention von Suizidalität für diesen Subtyp sein.
„Diese Erkenntnisse haben klinische Relevanz, da sie dazu beitragen
können, frühzeitig jene Patienten zu identifizieren, die auf eine
Immuntherapie besser ansprechen als auf Antidepressiva,“ sagt Elisabeth
Binder, Direktorin des MPI.
„Außerdem könnte die Behandlung von Suizidalität verbessert werden.
Hierfür ist allerdings noch weitere klinische Forschung erforderlich.“
Elisabeth Spiegelberger Max-Planck-Institut für Psychiatrie
Kraepelinstrasse 2-10
80804 München
Deutschland
Bayern
Anke Schlee
Telefon: 08930622263
E-Mail-Adresse: anke_schlee@psych.mpg.de
Telefon: 089 30622 263 516
E-Mail-Adresse: spiegelberger@psych.mpg.de
Nils Kappelmann (nils_kappelmann@psych.mpg.de)
Originalpublikation:
10.1001/jamapsychiatry.2020.3436