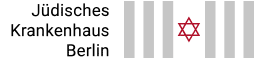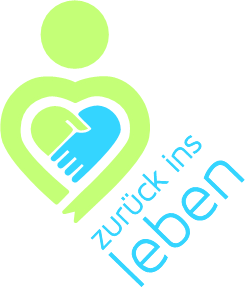Medizin am Abend Fazit:
Dopamin hilft auch beim Rechnen auf die Sprünge
Tierphysiologen der Universität Tübingen zeigen, dass bestimmte
Nervenzellen unter dem Einfluss des Botenstoffs Regeln besser verarbeiten
Der im Volksmund als „Glückshormon“ bezeichnete Botenstoff Dopamin ist
nicht nur für Motivation und Motorik des Menschen wichtig, sondern kann
Nervenzellen offenbar auch bei anspruchsvollen kognitiven Aufgaben positiv
beeinflussen. Torben Ott, Simon Jacob und Professor Andreas Nieder vom
Institut für Neurobiologie der Universität Tübingen konnten nun erstmals
zeigen, welchen Einfluss Dopamin auf Gehirnzellen während der Verarbeitung
von Regeln hat. Die Studie wurde am Donnerstag, 4. Dezember, in der
Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Neuron vorab veröffentlicht. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2014.11.012
Die Bedeutung des Botenstoffs Dopamin wird besonders offensichtlich, wenn
das Gehirn unterversorgt ist, wie etwa bei der Parkinsonschen Krankheit.
Der aus dem Gleichgewicht geratene Dopaminhaushalt führt dann zu
vielseitigen neurologischen Störungen. Vor allem Bewegungsvorgänge sind in
Mitleidenschaft gezogen, aber auch geistige Funktionen sind betroffen.
Denn gerade unser höchstes kognitives Steuerzentrum, der sogenannte
Präfrontalkortex im Stirnbereich, mit dem wir abstrakt denken,
regelbasierte Entscheidungen treffen und logisch schlussfolgern, wird
besonders intensiv mit Dopamin versorgt. Trotz der großen medizinischen
Bedeutung dieses Botenstoffs ist die Wirkung von Dopamin auf die
Informationsverarbeitung von Nervenzellen im gesunden Gehirn kaum
verstanden.
Um herauszufinden, wie Nervenzellen bei anspruchsvollen kognitiven
Aufgaben durch Dopamin beeinflusst werden, wurden Rhesusaffen so
trainiert, dass sie in der Lage waren, Rechenaufgaben nach der Regel
„größer als“ oder “kleiner als“ zu lösen. Aus jüngsten Studien der
Tübinger Forschungsgruppe war bekannt, dass bestimmte Hirnzellen im
Präfrontalkortex diese Regeln beantworteten: Eine Hälfte dieser
sogenannten Regelzellen wurde nur dann aktiv, wenn die Regel „größer als“
zu befolgen war, die andere Hälfte nur dann, wenn dem Tier die Regel
„kleiner als“ mitgeteilt worden war.
Während dieser Messungen wurden nahe den untersuchten Nervenzellen
physiologisch kleine Mengen verschiedener Substanzen ausgeschüttet, die
die gleiche oder entgegengesetzte Wirkung wie Dopamin haben und die sich
an dopaminempfindlichen Nervenzellen anlagern konnten. Überraschenderweise
zeigte sich, dass durch Stimulierung des Dopaminsystems die Regelzellen
leistungsfähiger wurden und die „Größer-als-„ oder „Kleiner-als-Regel“
noch deutlicher voneinander unterschieden. Dopamin hat also eine positive
Wirkung auf die Arbeitsqualität von Regelzellen.
Mit dieser Arbeit ergeben sich neue Erkenntnisse darüber, wie Dopamin
abstrakte Denkprozesse beeinflusst, wie sie etwa für die Anwendung von
Rechenregeln notwendig sind. „Wir beginnen mit den neuen Befunden zu
verstehen, wie Nervenzellen des Präfrontalkortex komplexes zielgerichtetes
Verhalten hervorbringen“, erklärt Torben Ott. Neben einem besseren
Verständnis der Grundlagen der Informationsverarbeitung in diesem
wichtigen Bereich der Großhirnrinde könnten die Ergebnisse auch für die
Medizin relevant sein. „Die neuen Erkenntnisse helfen uns, die Wirkung
bestimmter Medikamente besser zu interpretieren, die etwa bei schweren
psychischen Störungen zum Einsatz kommen“, sagt Professor Nieder: „Denn
solche Medikamente beeinflussen das Dopaminsystem im Präfrontalkortex auf
eine bisher schlecht verstandenen Weise.“
Originalpublikation: Torben Ott, Simon N. Jacob, and Andreas Nieder:
Dopamine Receptors Differentially Enhance Rule Coding in Primate
Prefrontal Cortex Neurons. Neuron, Online Early Edition, 4. Dec. 2014.
Medizin am Abend DirektKontakt
Prof. Dr. Andreas Nieder
Universität Tübingen
Institut für Neurobiologie
Lehrstuhl für Tierphysiologie
Tel.: + 49 7071 29-75347
andreas.nieder[at]uni-tuebingen.de