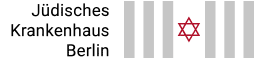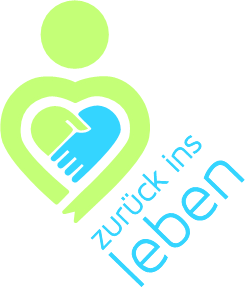Medizin am Abend Berlin Fazit: Virtuelles Gehirn gibt Einblicke in Gedächtnisprobleme bei Depression
- Während einer depressiven Phase verringert sich die Fähigkeit des Gehirns, neue Nervenzellen zu bilden.
Wie sich das auf das Gedächtnis auswirkt, haben Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum mit einem Computermodell untersucht.
Medizin am Abend Berlin ZusatzFachThema: Hausarztbesuch
- Dass Menschen sich in depressiven Phasen schlechter an aktuelle Ereignisse erinnern, war bereits bekannt.
Im Modell waren jedoch auch ältere Erinnerungen betroffen.
- Wie weit die Gedächtnisprobleme zurückreichten, hing von der Länge der depressiven Phase ab.
Das Team um den Neuroinformatiker Prof. Dr. Sen Cheng publizierte die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Plos One vom 7. Juni 2018.
Prof. Dr. Sen Cheng © RUB, Marquard
Computermodell simuliert depressives Gehirn
- Bei einer schweren Depression können Patientinnen und Patienten unter so starken kognitiven Einschränkungen leiden, dass man in manchen Fällen von einer Pseudo-Demenz spricht.
- Anders als bei der klassischen Form der Demenz verbessert sich das Erinnerungsvermögen wieder, wenn die depressive Phase abklingt.
Um diesen Prozess zu verstehen, entwickelten die Bochumer Forscher ein Computermodell, das die Besonderheiten des Gehirns von Patienten mit einer Depression widerspiegelt. Sie testeten, wie gut das Modell in der Lage ist, sich neue Dinge einzuprägen und bereits gespeicherte Erinnerungen abzurufen.
Wie bei echten Patienten wechselten sich auch in dem Computermodell depressive Phasen und Phasen ohne Symptome ab. Dabei bezogen die Forscher mit ein, dass Menschen in einer depressiven Phase weniger neue Nervenzellen bilden als in einer symptomfreien Phase.
In früheren Modellen waren Erinnerungen nur als ein einziges Aktivitätsmuster gespeichert worden. Die Gruppe um Sen Cheng modellierte Erinnerungen nun als Abfolge von mehreren Aktivitätsmustern. „So können auch zeitliche Abfolgen von Ereignissen im Gedächtnis gespeichert werden“, sagt Sen Cheng.
Gedächtnis stärker beeinflusst als gedacht
Wie die Forscher erwartet hatten, konnte das Computermodell Erinnerungen genauer abrufen, wenn der zuständige Teil des Gehirns viele neue Nervenzellen bilden konnte. Wurden weniger neue Nervenzellen gebildet, war es schwieriger für das Gehirn, ähnliche Erinnerungen zu unterscheiden und getrennt abzurufen.
- Das Modell hatte aber nicht nur Probleme, aktuelle Erinnerungen während einer depressiven Phase abzurufen.
- Es fiel ihm auch schwerer, auf Erinnerungen zurückzugreifen, die vor der Depression entstanden waren.
- Je länger eine depressive Phase andauerte, desto weiter zurückliegende Erinnerungen waren betroffen.
„Bisher geht man davon aus, dass nur während einer Depression Gedächtnisstörungen auftreten“, erklärt Sen Cheng. „Wenn unser Modell recht hat, hätten Depressionen weitreichendere Konsequenzen.
Alte Erinnerungen könnten bleibend geschädigt werden, selbst wenn die Depression bereits abgeklungen ist.“
Förderung
Die Studie wurde durch die Stiftung Mercator, die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 874 und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (Grant 01GQ15069) gefördert.
Originalveröffentlichung
Jing Fang, Selver Demic, Sen Cheng: The reduction of adult neurogenesis in depression impairs the retrieval of new as well as remote episodic memory, in: Plos One, 2018, DOI: 10.1371/journal.pone.0198406
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Prof. Dr. Sen Cheng
Computational Neuroscience
Institut für Neuroinformatik
Ruhr-Universität Bochum
Tel.: 0234 32 29486
E-Mail: sen.cheng@rub.de
Text: Judith Merkelt-Jedamzik, Julia Weiler
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
Postfach 10 21 48
44780 Bochum
Deutschland
Nordrhein-Westfalen
E-Mail-Adresse: info@ruhr-uni-bochum.de
Dr. Barbara Kruse
Telefon: 0234/32-22133
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: barbara.kruse@presse.ruhr-uni-bochum.de
Meike Drießen
Telefon: 0234/32-26952
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: meike.driessen@presse.rub.de
Jens Wylkop M.A.
Telefon: 0234/32-28355
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: jens.wylkop@uv.ruhr-uni-bochum.de
44780 Bochum
Postfach 10 21 48
44780 Bochum
Deutschland
Nordrhein-Westfalen
E-Mail-Adresse: info@ruhr-uni-bochum.de
Dr. Barbara Kruse
Telefon: 0234/32-22133
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: barbara.kruse@presse.ruhr-uni-bochum.de
Meike Drießen
Telefon: 0234/32-26952
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: meike.driessen@presse.rub.de
Jens Wylkop M.A.
Telefon: 0234/32-28355
Fax: 0234/32-14136
E-Mail-Adresse: jens.wylkop@uv.ruhr-uni-bochum.de