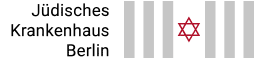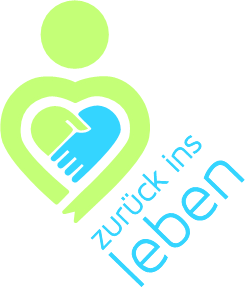Medizin am Abend Berlin Fazit: Übermannt von Gefühlen - Borderline-Patientinnen zeigen erhöhte Spiegelneuronen-Aktivität
Unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, auch BPS abgekürzt,
leiden nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Partner und
Bezugspersonen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Universitäten Ulm und Innsbruck haben nun mit Hilfe einer funktionellen
Bildgebungsstudie die Hirnaktivitäten von Patientinnen mit
Borderline-Störung untersucht und sind dabei auf einen interessanten
Befund gestoßen.
Sie durchleben extreme Stimmungsschwankungen, sind impulsiv und
haben häufig Probleme mit ihrem Umfeld.
 MRT-Aufnahme: Borderline-Patientinnen zeigen bei der Betrachtung von
Verlust- und Trauerszenen eine erhöhte Aktivierung eines spezifischen
Teils des Spiegelneuronensystems (somatosensorischer Kortex) Aufnahme: Prof. Roberto Viviani / Uni Ulm
Überdurchschnittlich oft sind es
junge Frauen, die vom Borderline-Syndrom betroffen sind.
MRT-Aufnahme: Borderline-Patientinnen zeigen bei der Betrachtung von
Verlust- und Trauerszenen eine erhöhte Aktivierung eines spezifischen
Teils des Spiegelneuronensystems (somatosensorischer Kortex) Aufnahme: Prof. Roberto Viviani / Uni Ulm
Überdurchschnittlich oft sind es
junge Frauen, die vom Borderline-Syndrom betroffen sind.
„Die emotionale Überempfindlichkeit von Borderline-Patientinnen wird
begleitet von einer erhöhten
Aktivität spezifischer Spiegelneuronen“,
erklärt Professor Roberto Viviani. Der Bildgebungsexperte forscht an der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III der Universität Ulm
zur
Emotionsregulierung. Spiegelneuronen sind im präfrontalen und im
sensorischen Cortex des Gehirns zu finden.
Das Besondere an diesen
Neuronen:
- Diese Nervenzellen werden bereits durch die Beobachtung von
Handlungen und die Fremdwahrnehmung von Gefühlen stimuliert.
Sie sind
damit entscheidend für das Lernen durch Nachahmung und das Nacherleben
von Emotionen.
Als eine Art Resonanzsystem im Gehirn reagieren diese
besonderen Nervenzellen sehr sensibel auf die Gefühle und Stimmungen
anderer, weshalb sie nicht nur für die Empathie-Fähigkeit des Menschen
entscheidend sind, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der so genannten
emotionalen Ansteckung spielen.
Die Ulmer Forscherinnen aus der
Arbeitsgruppe von Viviani haben nun in Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlerinnen aus Österreich herausgefunden, dass
BPS-Patientinnen besonders stark auf Szenen von Verlust und Trauer
reagieren.
Wie die Aufnahmen aus der magnetresonanztomografischen
Untersuchung (MRT) zeigten, waren bestimmte Areale im
Spiegelneuronensystem deutlich stärker aktiviert als in der „normalen“
Kontrollgruppe, wenn sie mit Verlust konfrontiert wurden. Entwickelt
wurden die Szenen am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck
von Dr. Karin Labek.
„Dieser Befund könnte erklären, warum Menschen, die
unter einer Borderline-Störung leiden, für solche negativen Gefühle so
empfänglich sind und so extrem darauf reagieren“, so Labek.
- Bereits
bekannt ist, dass überdurchschnittlich viele Borderline-Patientinnen und
Patienten auch unter Depressionen leiden.
Ein weiterer Befund, der bei der Untersuchung zutage trat, war für das
Forscher-Team noch überraschender.
So war auf den MRT-Aufnahmen im
Vergleich mit der gesunden Kontrollgruppe deutlich zu erkennen,
dass es
weitere Unterschiede im präfrontalen Cortex gab.
Hier zeigte sich, dass
bei den BPS-Patientinnen ein Bereich weitaus weniger stark aktiviert
war, der für die kognitive Beurteilung von Gefühlszuständen Anderer
entscheidend ist.
Dieser Bereich ist für die sogenannte „Mentalisierung“
verantwortlich, also für die reflektive Einstufung von
Gefühlswahrnehmungen.
- Diese Mentalisierung braucht es, um die Absichten
und Motivationen anderer Menschen einschätzen zu können.
- „Dieser Befund
könnte erklären, warum es den Borderline-Betroffenen so schwer fällt,
sich in andere hineinzuversetzen und deren Perspektive zu übernehmen“,
meint PD Dr. Zrinka Sosic-Vasic, Erstautorin der im Journal „NeuroImage:
Clinical“ veröffentlichten Studie.
„Beide Beobachtungen passen nicht nur sehr gut ins Bild dieser
besonderen Persönlichkeitsstörung.
Sie können auch dabei helfen, die
komplexen psychologischen Mechanismen aufzuklären, die dieser Störung
zugrunde liegen, und damit die neurobiologischen Grundlagen für neue
Psychotherapieansätze schaffen“, meint Viviani.
Möglicherweise lassen
sich hier Ansatzpunkte finden, die den Betroffenen dabei helfen,
Kommunikationssituationen zu reflektieren und ihr Gegenüber besser zu
verstehen.
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Prof. Dr. Roberto Viviani, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
III, Universität Ulm, E-Mail: roberto.viviani@uni-ulm.de , oder PD Dr.
Zrinka Sosic-Vasic, E-Mail: zrinka.sosic@uni-ulm.de
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm
Deutschland
Baden-Württemberg
Andrea Weber-Tuckermann
Telefon: 0731 - 5022024
E-Mail-Adresse:
andrea.weber-tuckermann@uni-ulm.de
Originalpublikation:
Literaturhinweis:
Mirror neuron activations in encoding of psychic pain in borderline personality disorder.
Zrinka Sosic-Vasic, Julia Eberhardt, Julia E. Bosch, Lisa Dommes, Karin
Labek, Anna Buchheim, Roberto Viviani. NeuroImage: Clinical, Volume 22,
2019, 101737, open access,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158219300877
Medizin am Abend Berlin Fazit: Gespiegelte Emotionen
-
Angst, Trauer oder Freude – emotionale Hypersensitivität ist ein
charakteristisches Merkmal von Menschen mit einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Ein Forschungsteam um Karin Labek und
Roberto Viviani von der Universität Innsbruck hat in Kooperation mit
Zrinka Socic-Vasic vom Universitätsklinikum Ulm gezeigt, dass die
Auseinandersetzung mit Trauer und Verlustsituationen von einer erhöhten
Aktivierung spezifischer kortikaler Areale begleitet wird, die dem
Spiegelneuronensystem zugewiesen werden.
 Höhere Aktivierung bei der Betrachtung der Trauerbilder in
spezifischen Teilen des Spiegelneuronensystems (somatosensorische
Areale) bei Borderline-PatientInnen in Vergleich zu Gesunden.
Höhere Aktivierung bei der Betrachtung der Trauerbilder in
spezifischen Teilen des Spiegelneuronensystems (somatosensorische
Areale) bei Borderline-PatientInnen in Vergleich zu Gesunden. Universität Innsbruck
Borderline-Patientinnen und -Patienten haben Schwierigkeiten, ihre
inneren Gefühlszustände und Emotionen richtig zu erkennen und zu
regulieren.
- Dieser Zustand kann zu einer extremen inneren Anspannung
führen, die Betroffene als unerträglich erleben.
„Menschen mit einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden darunter, dass sie sehr
intensive und für sie nicht differenzierbare Gefühle erleben.
Patientinnen und Patienten haben zudem große Schwierigkeiten, ihre
Emotionen angemessen zu regulieren.
Stimmungsschwankungen und depressive
Symptome begleiten in der Regel die Krankheit“, erläutert Karin Labek.
Impulsives, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten ist für die
Betroffenen eine Möglichkeit, diesen inneren Spannungszustand zu
bewältigen. „Können gerade junge Frauen ihre Emotionen oder Affekte
nicht richtig wahrnehmen oder regulieren, werden sie gerne zu voreilig
als ‚hysterisch‘ oder ‚übersensibel‘ bezeichnet.
Durch dieses
Nicht-Berücksichtigen der Kommunikation über die inneren psychischen
Zustände wird es für junge Borderline-Patientinnen noch schwieriger,
ihre emotionalen Erfahrungen richtig einzuordnen und zu verstehen“,
verdeutlicht Roberto Viviani, Professor am Institut für Psychologie, der
weiter erläutert, dass vor allem junge Frauen häufiger von einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen sind als Männer und Frauen
im Erwachsenenalter.
Die Angst, verlassen zu werden, sitzt bei
Betroffenen besonders tief. Deshalb ist der Umgang mit Verlust- und
Trennungssituationen für sie besonders schwierig und schmerzhaft. In
einer funktionellen Bildgebungsstudie konnten die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler auf neuronaler Ebene zeigen, dass bei Menschen mit
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung bei der Betrachtung von Bildern,
auf denen Verlust-, Trennungs- und Trauerszenen dargestellt sind,
Gehirnareale, die mit dem Spiegelneuronensystem assoziiert sind, stärker
aktiviert werden.
Emotionale Ansteckung
Die möglicherweise einfachste Form der emotionalen Kommunikation ist
laut Viviani die durch Spiegelneuronen verursachte „emotionale
Ansteckung“. „Das Wissen über Spiegelneuronen stammt aus der
neuropsychologischen Forschung bei Primaten. Bei Experimenten konnte
gezeigt werden, dass manche Neuronen im motorischen und prämotorischen
Cortex der Affen aktiv sind, auch wenn der Affe Bewegungen von anderen
nur beobachtet und sich selbst gar nicht bewegt“, erklärt der
Wissenschaftler. Dabei geht es um einen Mechanismus im Gehirn, der so
funktioniert, dass beobachtete und selbst ausgeführte Bewegungen von
denselben Neuronen encodiert werden.
Um mit den Mitmenschen erfolgreich
und empathisch interagieren zu können, ist es von zentraler Bedeutung,
in unterschiedlichen Kontexten soziale Signale mit den dazugehörenden
Emotionen richtig wahrzunehmen und zu interpretieren.
„Beim Menschen
liegt die Vermutung nahe, dass jener Teil des Spiegelneuronensystems,
der bei der Beobachtung eines emotionalen Ausdrucks aktiviert wird, für
Phänomene wie die ‚emotionale Ansteckung‘ zuständig ist“, so Labek.
Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
können sehr schnell von Emotionen wie Angst, Wut, Trauer, Scham oder
Begeisterung von ihrem Umfeld „angesteckt“ werden, ohne selbst durch ein
Erlebnis diese Emotion zu verspüren.
Die in der Studie festgestellte
erhöhte Aktivierung des Spiegelneuronensystems könnte ein zentraler
Baustein bei der Erklärung der emotionalen Instabilität dieser Störung
sein.
Psychischer Schmerz
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich dafür
interessiert, wie ansteckend die Emotion von psychischem Schmerz für
Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
ist. „Wir haben uns für das Thema von Schmerz, Trauer und Verlust
entschieden, da es für Betroffene sehr zentral ist“, so Viviani. Den
ausgewählten Probandinnen und Probanden wurden Bilder von einer
typischen Trauerhaltung eines Menschen gezeigt. Menschen ohne diese
Störung encodieren die Emotion, ohne selbst Trauer zu empfinden.
„Menschen mit Borderline sind hypersensitiv gegenüber anderen und können
diese Emotionen nicht einordnen.
Deswegen ist die emotionale Ansteckung
schon bei der Betrachtung von Bildern sehr stark“, erläutert Labek.
Spiegelneuronen sind Teil des Mechanismus, wodurch sie eine spezielle
Form des Mitgefühls erleben, die durch das Betrachten der Bilder
ausgelöst wird. „Dieses Verhalten ist sehr impulsiv und lebendig, geht
aber leider auch in die negative Richtung. Dies ist charakteristisch für
die emotionale Instabilität in der Borderline-Persönlichkeitsstörung“,
so die Wissenschaftlerin weiter. Eine emotionale Ansteckung gibt es auch
bei gesunden Menschen. Diese können aber im Gegensatz zu
Borderline-Patientinnen und -Patienten die Situation des Gegenübers
besser einschätzen. „Ein weiterer wesentlicher Befund ergab sich aus
einer weniger starken neuronalen Aktivierung in präfrontalen Arealen bei
Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Im Gegensatz zum
Spiegelneuronensystem sind die Aktivierungen in diesen Arealen mit
reflektiven Prozessen assoziiert. Diese Prozesse ermöglichen
beispielsweise eine adäquate Differenzierung von unterschiedlichen
Emotionen und sind die Voraussetzung für die Fähigkeit, sich in die
Gedanken und Gefühle von anderen Menschen hineinzuversetzen und damit
soziale Interaktionen besser verstehen und regulieren zu können“, sagt
Labek. Die Expertinnen und Experten sprechen bei dieser Art der Empathie
von „Mentalisierung“. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Menschen
mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung an Mentalisierungsdefiziten
leiden und deswegen die Absichten und Motivationen von anderen Personen
weniger gut einschätzen können. „Die Demonstration eines
Ungleichgewichts zwischen dem Spiegelneuronensystem und einem
reflektiven Verständnis von anderen liefert eine neurobiologische
Grundlage für innovative Psychotherapieansätze der
Borderline-Persönlichkeitsstörung, die die Fähigkeit fördern,
interpersonelle Kommunikation reflektiv zu verstehen“, so Viviani, der
verdeutlicht, dass so die Ergebnisse der Studie direkt wieder den
Patientinnen und Patienten in Form von neuen Therapieansätzen zugute
kommen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Magazin „NeuroImage
Clinical“ publiziert.
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
assoz. Prof. Roberto Viviani, PhD
Institut für Psychologie
Universität Innsbruck
Telefon: 0049 176 76132235
E-Mail: Roberto.Viviani@uibk.ac.at
Mag. Dr. Karin Labek
Institut für Psychologie
Universität Innsbruck
Mobil: 0043 699 19355940
E-Mail: Karin.Labek@uibk.ac.at
Christoph-Probst-Platz, Innrain 52
6020 Innsbruck
Österreich
Tirol
Mag. Uwe Steger
Telefon: 0043 - (0)512 - 507-32000
Fax: 0043 - (0)512 - 507-32099
E-Mail-Adresse:
uwe.steger@uibk.ac.at
Dr. Christian Flatz
Telefon: 0043 - (0)512 507-32022
Fax: 0043 - (0)512 507-32099
E-Mail-Adresse:
christian.flatz@uibk.ac.at
Originalpublikation:
NeuroImage Clinical: Mirror neuron activations in encoding of psychic pain in borderline personality disorder.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158219300877
DOI: 10.1016/j.nicl.2019.101737
Weitere Informationen für international Medizin am Abend Berlin Beteiligte
http://NeuroImage: Clinical:
https://www.journals.elsevier.com/neuroimage-clinical