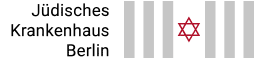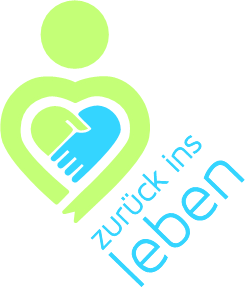Medizin am Abend Berlin Fazit: Wenn fremde Stimmen das Kommando übernehmen
Die neuere psychiatrische Forschung zeigt:
Schizophrenie beruht auf gestörter Informationsverarbeitung im Gehirn.
Das macht die Krankheit für Außenstehende weniger befremdlich und hilft Betroffenen in der Therapie.
- Sie hören Stimmen, vermuten Botschaften in bedeutungslosen Ereignissen oder fühlen sich ferngesteuert:
Die Symptome von Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung sind für Außenstehende befremdlich. Wie der Psychiater Dr. Robert Bittner in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Forschung Frankfurt“ der Goethe-Universität erklärt, beruht die Verwechslung von „eigen“ und „fremd“ auf verschiedenen Störungen der Informationsverarbeitung im Gehirn.
Medizin am Abend Berlin ZusatzFachThema: Elektronische Gesundheitskarte für geflüchtete Menschen im Land Berlin
- Schizophrene Psychosen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen.
Sie manifestieren sich typischerweise in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter und haben für die Betroffenen gravierende psychosoziale Folgen.Zudem gehören sie zu den Erkrankungen mit den höchsten direkten und indirekten Behandlungskosten.
Zu den Symptomen zählen Wahnideen, Halluzinationen, Ich-Störungen und formale Denkstörungen.
- Der Krankheitsverlauf ist in vielen Fällen durch wiederkehrende akute psychotische Episoden gekennzeichnet. Charakteristisch ist, dass die Betroffenen diese Phänomene während akuter Phasen unbeirrbar für real halten.
Bislang ist die Pathophysiologie schizophrener Psychosen nur teilweise verstanden. Deswegen gibt es lediglich Therapien, welche die Symptome bessern. „
Die Stigmatisierung der Erkrankung ist weit verbreitet.
Sie vergrößert das subjektive Leid der Betroffenen, stellt aber auch ein zusätzliches Hindernis für die Behandlung dar“, bedauert Dr. Robert Bittner von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsklinik Frankfurt.
Bittner erforscht seit vielen Jahren, was im Gehirn von Menschen mit schizophrenen Psychosen falsch läuft.
Inzwischen belegen eine Vielzahl von Studien mit bildgebenden Verfahren und an den Gehirnen Verstorbener, dass die Verbindungen von Nervenzellen im Gehirn und deren Kommunikation untereinander bei schizophrenen Psychosen grundlegend gestört sind.
Bei schizophrenen Patienten werden offenbar zu viele Nervenverbindungen während der Jugend abgebaut, was auch zu kognitiven Störungen führt.
Typische Wahnsymptome wie Beziehungsideen, bei denen die Betroffenen vollkommen alltägliche und für sie eigentlich bedeutungslose Ereignisse auf sich beziehen, erklärt die Forschung inzwischen durch die übermäßige Ausschüttung von Dopamin.
Sie führt dazu, dass äußere Reize in ihrer Bedeutung überbewertet werden.
Beispielsweise haben schizophrene Patienten den Eindruck, fremde Leute, denen sie auf der Straße begegnen, sähen sie bedeutungsvoll an oder redeten untereinander über sie, als wüssten sie Dinge aus ihrem Privatleben. Ähnliches gilt auch für die Wahnwahrnehmung, bei der Betroffene meinen, es würden ihnen beispielsweise durch Schilder oder Plakate persönliche Botschaften übermittelt.
Diese Überbewertung von bekannten oder irrelevanten Reizen kann man inzwischen gut medikamentös behandeln, indem man die übermäßige Wirkung von Dopamin blockiert.
Schließlich erklärt die Forschung Symptome wie Stimmenhören oder das Gefühl, „ferngesteuert“ zu werden, durch die Fehlregulation einer Gehirnfunktion, die es gesunden Menschen ermöglicht, zwischen inneren und äußeren Sinnesreizen zu unterscheiden.
Wenn wir beispielsweise ein Geräusch selbst erzeugen, werden Gehirnareale, die akustische Signale verarbeiten, mithilfe sogenannter Efferenzkopien darüber informiert.
Werden Efferenzkopien innerer Sprache fehlerhaft weitergeleitet, können wir nicht mehr unterscheiden, ob Stimmen von innen oder außen kommen.
Mit dem Erklärungsmodell der Informationsverarbeitungsstörung können Psychiater also die fremdartig oder bizarr anmutenden psychotischen Symptome der Schizophrenie zunehmend erklären.Das hilft nicht nur bei der Entwicklung neuer Therapien, sondern erleichtert es auch, den Betroffenen die Ursache ihrer Erkrankung zu erklären. „Schwererkrankte leugnen zwar den Krankheitswert ihrer psychotischen Symptome, sind sich in vielen Fällen aber ihrer kognitiven Defizite bewusst. Indem man ihnen diese Defizite neurobiologisch erklärt, kann man erfahrungsgemäß am besten ein Krankheitsverständnis aufbauen“, so Bittner.
Dies gelte auch für den Umgang mit den Angehörigen, bei denen in der Regel eine große Unsicherheit im Umgang mit den Erkrankten und ein großer Informationsbedarf herrschten.
Indem die Angehörigen einbezogen und deren Ressourcen und Kompetenzen gestärkt werden, erhalten die Betroffenen wichtige Unterstützung, was längerfristig zu einem günstigeren Krankheitsverlauf führt. Bittner hofft, dass dieses Modell auch der Öffentlichkeit ein klareres Bild schizophrener Psychosen vermittelt und dadurch der Stigmatisierung der Erkrankung entgegenwirkt.
Informationen: Dr. Robert Bittner, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsklinik Frankfurt, Tel.: (069)-6301-84713, Robert.Bittner@kgu.de.
Die aktuelle Ausgabe von „Forschung Frankfurt“ können Journalisten kostenlos bestellen: ott@pvw.uni-frankfurt.de. Im Internet steht die Ausgabe „Eigen und fremd“ unter: www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de.
Die Goethe-Universität ist eine forschungsstarke Hochschule in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt. 1914 mit privaten Mitteln überwiegend jüdischer Stifter gegründet, hat sie seitdem Pionierleistungen erbracht auf den Feldern der Sozial-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Quantenphysik, Hirnforschung und Arbeitsrecht. Am 1. Januar 2008 gewann sie mit der Rückkehr zu ihren historischen Wurzeln als Stiftungsuniversität ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Heute ist sie eine der zehn drittmittelstärksten und drei größten Universitäten Deutschlands mit drei Exzellenzclustern in Medizin, Lebenswissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Zusammen mit der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Mainz ist sie Partner der länderübergreifenden strategischen Universitätsallianz Rhein-Main.
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-Abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
idw - Informationsdienst Wissenschaft e. V.
Dr. Robert Bittner
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsklinik Frankfurt
Tel.: (069)-6301-84713
Robert.Bittner@kgu.de
Dr. Anne Hardy
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt am Main
Tel: (069) 798-12498
Fax: (069) 798-763 12531
hardy@pvw.uni-frankfurt.de
Internet: www.uni-frankfurt.de