Medizin am Abend Berlin Fazit: Amoktaten: Motivbündel von Wut, Hass und Rachegedanken
Gießener Team legt kriminologische Analyse von Amoktaten im Rahmen
des BMBF-geförderten Verbundprojekts TARGET vor –
Unterschiede zwischen
jugendlichen und erwachsenen Tätern – Warnsignale ernst nehmen –
Beratungsnetzwerk Amokprävention
Warum begehen Menschen Amoktaten, wie lassen sich Risikofaktoren
identifizieren und die Gewalttaten verhindern?
Ursachen und Prävention
von Amoktaten zu erforschen ist das Ziel des Verbundprojekts TARGET
(
Tat- und Fallanalysen hoch expressiver zielgerichteter Gewalt), an dem
die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) mit dem Teilprojekt
„Kriminologische Analyse von Amoktaten – junge und erwachsene Täter von
Amoktaten, Amokdrohungen“ beteiligt ist. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) hat das Verbundprojekt von März 2013 bis
Juni 2016 gefördert. Bei der Abschlusstagung des Gießener
TARGET-Teilprojekts am 23. Juni 2016 in Gießen wurden die Ergebnisse
vorgestellt. Im Rahmen dieses kriminologischen Teilprojekts wurden
interdisziplinär Fälle junger und erwachsener Täter von (versuchten)
Mehrfachtötungen anhand von Strafakten, Interviews und
psychiatrisch-psychologischen Gutachten analysiert.
Eine Untersuchung, die in den vergangenen Tagen erneut traurige
Aktualität bekam, wie Prof. Dr. Britta Bannenberg, Professorin für
Kriminologie an der JLU und Leiterin des Gießener Teilprojekts
feststellt:
„Die jüngsten Taten durch Einzeltäter in Orlando oder das
Attentat auf Jo Cox in Großbritannien zeigen Täterpersönlichkeiten, die
in ihrer Mischung aus Hass und Extremismus auch in dieser Studie
wiederzufinden sind.“
Jugendliche Täter und selten Täterinnen
Das Team von Prof. Bannenberg hat im Rahmen von TARGET nahezu alle
Amoktaten junger Täter bis 24 Jahre in Deutschland zwischen 1990 und
2016 untersucht – insgesamt 35 Fälle, darunter die Taten aus Erfurt,
Emsdetten und Winnenden/Wendlingen.
Die Gießener Studie zeigt, dass die
jungen Amoktäter eine geplante Mehrfachtötung begehen, weil sie als
sonderbare Einzelgänger psychopathologisch auffällig sind und ein
Motivbündel von Wut, Hass und Rachegedanken entwickeln, das nicht
rational begründet ist.
Ihre Persönlichkeit zeigt narzisstische und
paranoide Züge, die jungen (ganz überwiegend männlichen) Täter sind
extrem leicht zu kränken, aber nicht impulsiv oder aggressiv auffällig.
Sie fühlen sich oft gedemütigt und schlecht behandelt, ohne dass die
Umwelt dieses nachvollziehen kann und beginnen, im Internet nach
Vorbildern und Ventilen für ihre Wut zu suchen.
- Sie sinnen lange über
„Rache“ und eine grandiose Mordtat nach, entwickeln ausgeprägte Gewalt-
und Tötungsphantasien.
Insbesondere in der Tat an der Columbine High
School im April 1999, die im Internet in vielfältiger Form auffindbar
ist, finden sie eine Möglichkeit der Identifikation, so die Erkenntnisse
der Forscherinnen und Forscher.
Das zeigt, dass es jugendtypische Aspekte dieser Taten gibt:
- Die
Inszenierung der Tat und die Selbststilisierung als sich rächendes
Opfer, was mit der Realität nichts gemein hat, ist eine jugendtypische
Facette dieser Taten.
Deshalb haben die in der Öffentlichkeit häufig als
Ursache missverstandenen Ego-Shooter, Gewaltvideos und hasserfüllten
Liedtexte sowie die Waffenaffinität nach Ansicht der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine besondere Bedeutung:
- Als Inspiration und Verstärker für die schon vorhandenen
Gewaltphantasien spielen sie eine Rolle bei der Selbstdarstellung der im
realen Leben erfolglosen, überforderten und sich ständig gekränkt
fühlenden Täter. Teilweise planen die Täter die Medienresonanz bewusst
ein.
Verwenden die Täter Schusswaffen, ist die Opferzahl in der Regel
besonders hoch. Die jungen Täter griffen bei den untersuchten Fällen
meist auf nicht ordnungsgemäß gesicherte Schusswaffen im Haushalt
zurück. Alternativ verwendeten sie Hieb- und Stichwaffen sowie
Brandsätze.
Die Forscherinnen und Forscher stellten sowohl bei den jugendlichen als
auch bei der heterogeneren Gruppe der erwachsenen Täter eine hohe
Bedeutung des Suizids bzw. des Suizidversuchs nach der Tat fest.
- Es
handelt sich hier nicht um depressive Verzweiflung, sondern um die
Inszenierung eigener Großartigkeit.
Die Täter demonstrieren ihre Macht
und ihren Hass auf die Gesellschaft und/oder besonders attackierte
Gruppen mit einer öffentlichkeitswirksamen Mehrfachtötung, der der
Suizid folgt.
Erwachsene Täter und seltener Täterinnen
Das Gießener Team analysierte zudem eine Auswahl von 40 erwachsenen
Tätern – überwiegend männliche Einzelgänger, die Studie umfasste nur
zwei Frauen.
Bei den Erwachsenen dominiert die Psychose vor allem in
Form der paranoiden Schizophrenie bei etwa einem Drittel, ein weiteres
Drittel hat eine paranoide Persönlichkeitsstörung.
- Auch die anderen
erwachsenen Täter sind psychopathologisch auffällig und zeigen häufig
narzisstische und paranoide Züge. Sie sind leicht zu kränken, fühlen
sich schlecht behandelt und nicht beachtet. Es finden sich auch
psychopathische Persönlichkeiten ohne Empathie mit sadistischen
Anteilen. Die Erwachsenen in den analysierten Fällen sind häufiger
querulatorisch auffällig und scheitern in Beruf und Partnerschaft.
- Anders als bei jugendlichen Tätern spielt bei ihnen Alkohol- und
Drogenmissbrauch eine Rolle als Verstärker.
-
Erwachsene, so ein weiteres Ergebnis der Studie, orientieren sich nicht
konkret an medialen Vorbildern und ahmen auch keine Kleidungsstile und
andere jugendtypische Attribute nach, sie hinterlassen seltener
Selbstzeugnisse.
„Allerdings dürften auch sie von Zeitströmungen und
Medienberichten über extreme Gewalttaten inspiriert sein“, so Prof.
Bannenberg. Kern ihrer Motive sei Hass und Groll auf bestimmte Gruppen
oder die Gesellschaft als Ganzes, weshalb sie ihre Taten auch oft als
Racheakte verstehen.
Prävention und Prognose
Bei der Prävention ist nach Aussage der Studie danach zu unterscheiden,
ob die Täter vor der Tat erkennbar sind und welche
Behandlungsmöglichkeiten nach der Inhaftierung bzw. der Unterbringung im
Maßregelvollzug wirksam sind.
- In der Untersuchung zeigte sich, dass
junge Täter im schulischen Kontext vor allem ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern als seltsam oder bedrohlich auffallen und frühe
Interventionen häufiger sind als bei Erwachsenen. Auch ist das Droh- und
Warnverhalten der jungen Täter ausgeprägter.
Bei Erwachsenen werden viele Warnsignale und Andeutungen der Tat häufig
nicht ernst genommen oder nur im familiären Umfeld registriert. Polizei
und Psychiatrie werden in der Regel nicht informiert – auch nicht, wenn
die Personen als Sportschützen Zugang zu Schusswaffen haben.
Auch im
beruflichen Kontext wird nicht die Polizei eingeschaltet.
Eher versucht
man, die betreffenden Mitarbeiter zu kündigen.
„Die Prognose verurteilter und untergebrachter Täter ist nur dann gut,
wenn sich die Persönlichkeitsstörung nicht verfestigt, persönliche
Entwicklungsperspektiven ergriffen werden und eine Distanzierung von den
Hassgedanken gelingt“, so Prof. Dr. Britta Bannenberg. „Dies ist
insgesamt eher selten.“
Zur Studie
Als Amoktaten wurden in der Studie beabsichtigte oder vollendete
Mehrfachtötungen gewertet. Die qualitativen Fallanalysen stützen sich
auf Strafakten und Asservate, Selbstzeugnisse der Täter, Interviews mit
ihnen, den Opfern und Menschen aus dem sozialen Umfeld sowie auf
psychiatrisch-psychologische Einschätzungen. Sofern die soweit die
Täter nach der Tat durch Suizid oder provozierten Suizid verstorben
sind, erfolgte auch eine psychologische Autopsie, bei der Daten aus der
Vergangenheit der Personen genutzt werden, um Motive für die Tat zu
finden.
Beratungsnetzwerk Amokprävention
-
Prof. Dr. Britta Bannenberg berät kostenlos Menschen bei der Abklärung
einer Amok-Bedrohung (Gefahrenprognose) und beim Umgang mit der
bedrohlichen Person. Wer sich Sorgen macht über das Verhalten einer
Person, sich unsicher ist, ob von jemandem eine Gefahr ausgeht, ob man
die Polizei benachrichtigen oder externe Berater einschalten sollte,
kann sich an der Professur für Kriminologie der JLU Rat holen. Prof.
Bannenberg arbeitet dabei mit dem Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden
zusammen.
-
Telefon: 0641 99-21571 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr)
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
Prof. Dr. Britta Bannenberg
Professur für Kriminologie
Licher Straße 64, 35394 Gießen
Telefon: 0641 99-21570
Caroline Link
Justus-Liebig-Universität Gießen
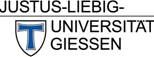
Weitere Informationen für international Medizin am Abend Berlin Beteiligte
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/professuren/bannenberg
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/professuren/bannenberg/news/beratungsnetzwerk... (Beratungsnetzwerk Amokprävention)


































