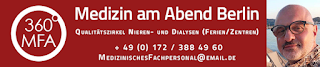Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Viele Amputationen bei Patienten mit kritischer Ischämie könnten verhindert werden
Die Deutsche Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. kritisiert, dass in Deutschland noch immer viele PatientInnen mit einer kritischen Ischämie ohne vorherige, leitliniengerechte Diagnostik und Therapie amputiert werden.
Hier gilt es zum Wohle der PatientInnen aufzuklären.
Anteil an diagnostischer Angiographie und Revaskularisation vor einer ischämischen Amputation Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e. V.
Eine kürzlich im European Journal of Vascular and Endovascular Surgery veröffentlichte Studie von Makowski et al. (1) vom Universitätsklinikum Münster zeigt anhand von ca. 40.000 ischämie-bedingten Amputationen der AOK-Versicherten, dass etwa ein Drittel aller Amputationen auf dem Boden einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) durchgeführt wurden, ohne dass ein vorheriger Revaskularisationsversuch zwecks Bein-Erhalt unternommen wurde.
Bei 22% der Amputationen erfolgte noch nicht einmal eine Bildgebung (intraarterielle DSA, CT- oder MR-Angiographie), um zu beurteilen, ob eine Revaskularisation möglich und ggf. erfolgreich gewesen wäre.
Dieselbe Arbeitsgruppe hatte bereits 2015 eine ähnliche Studie anhand der BARMER-Versicherten durchgeführt mit ähnlichen alarmierenden Zahlen (2).
„Alle nationalen und internationalen Leitlinien zur Behandlung von pAVK und kritischer Bein-Ischämie propagieren eine rasche Diagnostik - und im Falle einer relevanten Ischämie - die Durchführung einer Revaskularisation, sei es endovaskulär oder gefäßchirurgisch“, sagt die Erstautorin der Studie, Dr. Lena Makowski.
Warum das sehr gut evidenz-basierte und daher in den Leitlinien empfohlene Vorgehen mit adäquater Diagnostik und Revaskularisation vor einer Amputation nicht konsequent in die Praxis umgesetzt wird, kann sich Prof. Dr. med. Holger Reinecke, Direktor der Klinik für Kardiologie I: Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und Angiologie am Universitätsklinikum Münster, nicht erklären.
„Es ist vorstellbar, dass bei einigen Patienten eine Revaskularisation nicht möglich oder nicht sinnvoll ist.
Wir wissen aber aus bundesweiten Registern, wie dem CRITISH-Register, dass der Anteil der primär notwendigen Amputierten <5% beträgt.
Und eine erfolgreiche Revaskularisation kann mittlerweile in Zentren mit hoher gefäßmedizinischer Expertise bei >95% der Betroffenen erreicht werden, wie das RECCORD-Register https://reccord.de/ der Deutschen Gesellschaft für Angiologie zeigt“, sagt Reinecke.
- Die Studie von Makowski et al. zeigt auch einen weiterhin bestehenden Mangel an sekundär-präventiven Maßnahmen wie die Medikation mit Plättchenhemmern und Statinen.
- Beide Substanzen senken nachweislich kardiale Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle aber auch Bein-Ereignisse wie Amputation und wiederholte Eingriffe und sind daher in den Leitlinien mit dem höchsten Empfehlungsgrad versehen.
In der aktuellen Studie zeigt sich, dass in einem zwei-Jahres-Follow-Up nach ischämisch bedingter Amputation knapp die Hälfte kein Statin und ca. 30% keinen Plättchenhemmer erhielten.
„Dies zeigt eine dramatische Unterversorgung der pAVK-PatientInnen, welche zum Teil die schlechte Prognose erklären können.
Hier besteht weiterhin ein dringlicher Aufklärungs- und verbesserungsbedarf“, schlussfolgert Dr. Makowski.
Viele Amputationen bei Patienten mit kritischer Ischämie könnten verhindert werden
Dr. Lena Makowski
Universitätsklinikum Münster
Klinik für Kardiologie I
Albert-Schweitzer-Campus 1,
48149 Münster
Katarina Pyschik Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V.
Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Deutschland
Berlin
Doreen Goll
Telefon: 030 20 88 88 31
Fax: 030 20 88 88 33
E-Mail-Adresse: info@dga-gefaessmedizin.de
Telefon: 030/30888831
Fax: 030/30888833
E-Mail-Adresse: n.langbehn@dga-gefaessmedizin.de
Originalpublikation:
(1) Makowski L, Engelbertz C,
Köppe J, Dröge P, Ruhnke T, Günster C, et al.; Contemporary Treatment
and Outcome of Patients with Ischaemic Lower Limb Amputation: A Focus on
Sex Differences. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023 Jun
22:S1078-5884(23)00463-X. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.06.018 Epub ahead of print. PMID: 37355161.
(2) Reinecke H, Unrath M, Freisinger E, Bunzemeier H, Meyborg M,
Lüders F, et al. Peripheral arterial disease and critical limb
ischaemia: still poor outcomes and lack of guideline adherence. Eur
Heart J 2015;36:932–938